












Gordon`s 8 Wohn- und Arbeitsstellen
Gordon`s Wohnsitz unter dem Schutz des Glaubens

Das Zentrum "Scheunenviertel"

















Johannes Calvin
Johannes Calvin 10. Juli 1509 in Noyon, Picardie; † 27. Mai 1564 in Genf war einer der einflussreichsten systematischen Theologen unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts. Sein Hauptwerk, die Institutio Christianae Religionis, wird als eine „protestantische Summa“ bezeichnet.
Die Verfolgung der französischen Protestanten unter König Franz I. zwang den Juristen, Humanisten und theologischen Autodidakten Calvin wie viele Gleichgesinnte zu einem Leben im Untergrund, schließlich zur Flucht aus Frankreich.
Die Stadtrepublik Genf hatte bei seiner Ankunft dort (1536) gerade erst die Reformation eingeführt.
Der Reformator Guillaume Farel machte Calvin zu seinem Mitarbeiter. Nach zweijähriger Tätigkeit wurden Farel und Calvin vom Stadtrat ausgewiesen.
Martin Bucer lud Calvin nach Straßburg ein. 1539 erhielt er eine Professur für Theologie an der Hohen Schule von Straßburg. Außerdem war er Pfarrer der französischen Flüchtlingsgemeinde.
Als ihn der Stadtrat von Genf zurückrief, war Calvins Stellung wesentlich stärker als bei seinem ersten Genfer Aufenthalt.
Er hatte Erfahrungen mit der Gemeindeorganisation gewonnen, die ihm jetzt zugutekamen.
Im Herbst 1541 kam Calvin nach Genf und arbeitete umgehend eine Kirchenordnung aus. Calvins Rückhalt in den folgenden Jahren war das Pastorenkollegium (Compagnie des pasteurs).
Der starke Zuzug verfolgter Hugenotten veränderte die Bevölkerungsstruktur Genfs und die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat, was 1555 zur Entmachtung der Calvin-kritischen Ratsfraktion führte. Die 1559 gegründete Akademie profitierte vom Ruf Calvins und machte Genf zum Ziel von Studenten aus mehreren europäischen Staaten.
Calvins Wirken in Genf war durch schwere Konflikte gekennzeichnet, unter denen zwei hervorstechen:
Die Vertreibung Jérôme-Hermès Bolsecs.
Er hatte Calvins Prädestinationslehre kritisiert, wurde deshalb 1551 aus Genf ausgewiesen und verfasste später eine viel rezipierte, polemische Calvin-Biografie.
Die Hinrichtung des Antitrinitariers Michel Servet (1553). Calvin hatte bereits die Römische Inquisition, die Servet im französischen Vienne verhörte, mit Belastungsmaterial versorgt. Servet floh vor seiner Hinrichtung nach Genf; dort wurde er auf Betreiben Calvins ebenfalls vor Gericht gestellt.
Es war ein politischer Prozess, den der Kleine Rat der Stadt an sich zog. Calvin war daran als theologischer Gutachter, nicht als Richter beteiligt.
Er befürwortete das Todesurteil und rechtfertigte es nachträglich gegen die Kritik des Basler Humanisten Sebastian Castellio.
Calvins theologisches Hauptwerk ist die Institutio Christianae Religionis, die aber zusammengesehen werden sollte mit Calvins Bibelkommentaren. Die Institutio ist einerseits aus dem Bibelstudium erwachsen, andererseits aus einer intensiven Auseinandersetzung mit den altkirchlichen Dogmen und den Schriften der Kirchenväter, besonders Augustinus von Hippo.
Das Zentrum von Calvins Theologie wird unterschiedlich bestimmt: die Majestät Gottes (Benjamin B. Warfield) oder Christus als der Mittler (Wilhelm Niesel); die doppelte Prädestination ist ein Nebenthema.
Die Kirchenordnung hatte für Calvin religiöse Relevanz, denn die Kirche solle in ihrer Gestalt ihrem Auftrag entsprechen. Kirchenzucht sei sowohl für die Integrität der Kirche als auch für die persönliche Heiligung der Mitglieder unverzichtbar.
Calvinismus
Der Begriff „Calvinismus“ wurde 1552 von dem Gnesiolutheraner Joachim Westphal geprägt. Calvin selbst lehnte diese Bezeichnung entschieden ab.
Die Selbstbezeichnung als „reformierte Kirchen“ verdeutlicht, dass diese Kirchen sich nicht als Neugründung einer Person des 16. Jahrhunderts, nämlich Calvins, verstehen, sondern als Teile der einen, seit der Zeit der Apostel bestehenden Kirche.
Diese Selbstbezeichnung wurde im Friedensvertrag von Osnabrück 1648 reichsrechtlich als Name einer Konfessionskirche anerkannt.
Calvinistae und Calviner waren demgegenüber polemische Fremdbezeichnungen seitens der beiden anderen reichsrechtlich anerkannten Konfessionskirchen (Katholizismus und Luthertum).
„‚Calvinismus‘ ist, wenigstens im deutschsprachigen Bereich, für Reformierte eine – oft polemische – Fremdbezeichnung, die sie mit Grund von sich weisen und nicht als Selbstbezeichnung gebrauchen.“
Lehre
Die Theologie Calvins betont die unbedingte Heiligkeit Gottes. Alles Menschenwerk, sogar die Glaubensentscheidung und nicht zuletzt der Kultus der katholischen Kirche mit Sakramenten, Reliquien oder Ablass galten ihm als Versuche, die Souveränität Gottes einzuschränken und an Irdisches zu binden. Die zum Teil schroffen Züge von Calvins Offenbarungs-, Gnaden- und Erlösungslehre wurden in der Auseinandersetzung der Calvinisten mit den „Arminianern“ im 17. Jahrhundert durch die Beschlüsse der Dordrechter Synode und durch das Bekenntnis von Westminster noch verschärft; das gilt insbesondere für Calvins Lehre von der doppelten Prädestination, wonach Gott ein für alle Mal vorherbestimmt habe, ob ein bestimmter Mensch auf dem Weg zur ewigen Seligkeit oder zur ewigen Verdammnis sei.
Die vier reformatorischen „Soli“ als Basis
Wie bei fast allen Richtungen, die aus der Reformation hervorgingen, gehören die vier Soli zur Basis des Calvinismus
sola scriptura – allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens (nicht die Tradition),
solus Christus – allein Christus (nicht die Kirche) hat Autorität über Gläubige,
sola fide – allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt (nicht durch gute Werke),
sola gratia – allein durch die Gnade wird der Mensch gerettet
Die fünf Punkte des Calvinismus
Im frühen 20. Jahrhundert entstand in den Vereinigten Staaten eine populäre Darstellung von „Fünf Punkten des Calvinismus“ unter dem Akronym TULIP.
Inhaltlich handelt es sich um eine Simplifizierung der Lehrregeln von Dordrecht bei geänderter Reihenfolge der Themen. Weder kann der klassische Calvinismus auf fünf Punkte reduziert werden, noch stammen alle fünf Formulierungen von Calvin.
Völlige Verdorbenheit/Unfähigkeit
Aufgrund des Sündenfalls beherrscht die Sünde den ganzen Menschen, sein Denken, seine Gefühle und seinen Willen.
Daher ist der natürliche Mensch nicht fähig, die Botschaft des Evangeliums zu verstehen, er ist geistlich völlig hilflos und verloren. Der Mensch kann Gottes rettende Botschaft erst verstehen, nachdem er durch den Heiligen Geist dazu befähigt wurde (Röm 5,12 LUT, Mk 4,11 LUT).
Die Formulierung ist missverständlich: Die Canones von Dordrecht lehren nicht, dass der Mensch gar nichts Gutes tun könne, sondern, dass der Mensch nicht imstande sei, seine Erlösung durch eigene Anstrengung zu erreichen.
Bedingungslose Erwählung
Calvins Lehre der doppelten Prädestination wurde von der Dordrechter Synode in Auseinandersetzung mit dem Arminianismus modifiziert Dordrecht.
Gott in seiner Barmherzigkeit hat aus seinem ewigen Ratschluss, nicht aus dem Vorherwissen ihres zukünftigen Glaubens einige Menschen erwählt und zum Glauben bestimmt.
Die übrigen Menschen überlässt er ihrer eigenen Bosheit. Die Gründe, warum Gott einige erwählt hat, sind unbekannt. Es ist aber offensichtlich, dass das nicht aufgrund irgendwelcher guten Werke von Seiten des Erwählten geschehen ist. Die Erwählung ist insofern nicht an irgendwelche in der Person des Erwählten liegende Bedingungen geknüpft (Röm 9,15 LUT.21LUT).
Begrenzte Versöhnung/Sühne
Das ist der Glaube, dass Jesus Christus nicht gestorben ist, um alle Menschen zu retten. Sein Erlösungswerk ist nur an die auserwählten Sünder, die durch ihn gerettet sind, gerichtet (Mt 26,28 LUT, Eph 5,25 LUT).
Die Formulierung ist missverständlich: Die Canones von Dordrecht betonen die universale Dimension des Kreuzes Christi.
Unwiderstehliche Gnade (Irresistible grace)
Gemeint ist, dass man die Gnade der Erwählung nicht ausschlagen kann. Der Mensch hat in dieser Hinsicht also keinen freien Willen, da er tot ist in seinen Vergehungen und deswegen keinerlei Macht hat, sich für Gott zu entscheiden (Eph 2,1 LUT). Nur durch den Ruf Gottes kann der Mensch geistlich wieder zum Leben erweckt werden (Eph 2,5 LUT), und somit zu Gott kommen. Jeder Mensch, den Gott erwählt hat, werde Gott erkennen. Die Erwählten können dem Ruf Gottes nicht widerstehen (Joh 6,44 LUT, Röm 8,14 LUT).
Die Formulierung ist missverständlich: Die Canones von Dordrecht lehren nicht, dass die Gnade „unwiderstehlich“ sei, sondern dass Gottes Gnade trotz menschlicher Widerstände ihr Ziel erreiche.
Die Beharrlichkeit der Heiligen
Die einmal Geretteten werden gerettet bleiben. Es sei unmöglich, Gottes Gnade wieder zu verlieren (Röm 8,28 LUT, Joh 6,39 LUT). Diese „Beharrlichkeit“ wird mit dem Fachbegriff „Perseveranz“ bezeichnet.
Die Formulierung ist missverständlich: Die Canones von Dordrecht betonen mehr Gottes gnädige Bewahrung als das menschliche „Ausharren.“
Historische Einordnung von TULIP
Die Fünf Punkte des Calvinismus stehen in keiner historischen Beziehung zu den Lehrregeln von Dordrecht und geben diese auch nicht unverkürzt wieder (was besonders bei den Formulierungen Total depravement und Limited Atonement kritisiert wird).
Das schwerwiegendste Problem ist aber folgendes: Die Lehrregeln stehen als Bekenntnisschrift nicht für sich, sondern stellen eine Ergänzung zu den beiden älteren Bekenntnisschriften der niederländischen reformierten Kirche dar, der Confessio Belgica und dem Heidelberger Katechismus.
Während die Confessio Belgica und der Heidelberger Katechismus jeweils das ganze Spektrum der Glaubensinhalte darstellen, haben die Lehrregeln nur den Anspruch, einige aktuelle Streitfragen zur Prädestination verbindlich zu klären.
Diese Lehrregeln von Dordrecht wurden 1619 den beiden bisherigen niederländischen Bekenntnisschriften hinzugefügt. Ihre Bedeutung besteht darin, die konfessionelle Identitätsbildung des Reformiertentums in Abgrenzung zum Luthertum gefestigt zu haben. Neben der Christologie und der Abendmahlslehre war die Prädestinationslehre das dritte Feld innerprotestantischer Differenzen, und hierfür boten die Lehrregeln im Reformiertentum konsensfähige Formulierungen.
Nach Margit Ernst-Habib sind die Fünf Punkte des Calvinismus der Versuch einer retrospektiven Identitätsbestimmung durch Auflisten von Lehrpunkten (essential tenets), die angeblich die Essenz des klassischen Calvinismus beinhalten. Eine beanspruchte unveränderliche Gültigkeit stehe aber in Spannung zu dem hermeneutischen Grundsatz reformierter Kirchen, dass die Heilige Schrift dem Bekenntnis vorgeordnet ist und Bekenntnissätze nach besserer Belehrung durch die Heilige Schrift revidierbar sind.[
Weitere Merkmale des Calvinismus
Darüber hinaus ist der Calvinismus gekennzeichnet durch:
eine starke Ausprägung der Bundestheologie,
protestantische Askese,
strenge Kirchenzucht, das heißt die Gemeinde kann verschiedene Strafen gegen ihre Mitglieder verhängen, wenn sich diese unmoralisch verhalten,
Fleiß und Arbeitseifer, wobei wirtschaftlicher Wohlstand in der protestantischen Ethik mitunter als Zeichen der Erwählung interpretiert wird, Unabhängigkeit vom Staat,
nicht-hierarchische Kirchenordnung (Allgemeines Priestertum),
Abendmahl als Erinnerungsfeier, kein Glaube an die Realpräsenz.

.webp)



.png)








.jpg)





.jpg)
Das Neue Jerusalem (auch Himmlisches Jerusalem genannt) entspringt einer Vision aus dem neutestamentlichen Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, wonach am Ende der Apokalypse eine neue Stadt, ein neues Jerusalem, entstehen wird.
Dies geschieht, nachdem der alte Himmel und die alte Erde vergangen sind.

GEBURTSORT OSKAR ZIEHTEN-KRANKENHAUS
MAXIMILIANSTRASSE 24 - ECKE EMANUALSTRASSE
BERLIN LICHTENBERG


.png)


PANORAMA NEUES JERUSCHALEM





















ZEITLOSE - METROPOLE - BERLIN


"EIN EINMALIGES PROJEKT"
Die Saniererin des St. Franziskus Doms in Berlin

Für die Berliner Katholiken war es ein Tag der Freude:
Am 24. November wurde die umgebaute Hedwigs-Kathedrale wiedereröffnet – mehr als sechs Jahre nach ihrer baubedingten Schließung.
Im Interview mit katholisch.de äußert sich Berlins Erzbischof Heiner Koch über die bisherigen Gottesdienste in der Kathedrale und seine persönlichen Erfahrungen dabei.
Außerdem spricht er über die Sorgen um den exponiert stehenden Altar, die neue Nähe zu den Gläubigen in der runden Kirche und die deutlich gestiegenen Baukosten beim benachbarten Bernhard-Lichtenberg-Haus.
Dass er nun im Zentrum der Kathedrale steht und eine enge Verbindung mit der zum Himmel hin geöffneten Kuppel bildet, ist ein wunderbares Zeichen.
Dadurch wird klar, dass Jesus Christus der Mittelpunkt ist, um den wir uns als Kirche versammeln.
Wir leben als Christen von der Mitte und sind zur Mitte berufen – dieses ganz katholische Element macht der neue Altar in Sankt Hedwig deutlich.


Berlin (KNA) Ob sie schon mal für ein ähnliches Projekt verantwortlich war? "Nein", sagt Elena Cenci frei und offen und lacht.
"Der Umbau einer Kathedrale ist ein einmaliges Projekt, auch für mich. Meine bisherige Tätigkeit als Architektin betraf die Planung und Projektleitung von größeren Wohnungsbauvorhaben sowie Hotel- und Bürobauten."
Seit fünf Jahren leitet die gebürtige Italienerin, die an der Technischen Universität Berlin Architektur studiert hat, die umfassende Sanierung der Sankt-Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz und - als wäre dies noch nicht genug - auch den Neubau des angrenzenden Bernhard-Lichtenberg-Hauses, dem zukünftigen Dienst- und Wohnsitz des Berliner Erzbischofs.
Die Arbeit von zwei Architekturbüros muss dafür von Cenci koordiniert werden.
Doch von Erschöpfung oder Überlastung ist bei ihr nichts zu bemerken.
Die zierlich-vitale Frau mit den leuchtend blauen Augen strahlt Energie und Souveränität aus, als sie zusammen mit dem Berliner Dompropst Tobias Przytarski durch Berlins "heiligste Baustelle" ("B.Z.") führt. Am 24. November soll die feierliche Wiedereröffnung der Kathedrale sein.
Cenci ist überzeugt, dass es mit dem Termin klappt. Von der Pandemie hat sie sich mit ihrem Team nicht stoppen lassen, auch nicht von der Inflation im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine.
Die Mischung aus Gottvertrauen und Kompetenz scheint ihr in die Wiege gelegt worden zu sein.
Die spirituelle Dimension dieser Arbeit bedeute ihr etwas, sagt sie fröhlich, ohne ins Detail zu gehen. Sie lässt lieber die Bauelemente sprechen.
Geheimnisvolles Zusammenspiel von Altar und Oberlicht
Da wäre zum Beispiel das geheimnisvolle Zusammenspiel des schon geweihten Altars im Zentrum der Kirche und dem Oberlicht in der Rotunde, das nach der Sanierung möglich ist.
Denn: Statt des Kreuzes, das auf den Eingangsgiebel versetzt wurde, wird die Kuppel der Kathedrale nun von einer runden Öffnung ("Opaion") geschmückt, die dem Pantheon in Rom nachempfunden ist.
Sicherheitshalber wird die Öffnung aber von einem Fenster mit Kunststoff abgedeckt, da auf das Berliner Wetter weniger Verlass ist. Die Linie zwischen Altar und Oberlicht lässt sich theologisch deuten. Sie soll für den Dialog von Gott und Mensch stehen.
Im Zentrum der Unterkirche (Krypta) hingegen befindet sich ein auffällig großes Taufbecken, das nach Worten von Cenci und Przytarski auch Ganzkörpertaufen möglich machen soll.
Ein Einfall, der zunächst ungewöhnlich wirkt, denn vermutlich hat es im Erzbistum Berlin noch nie eine solche Taufkultur gegeben.
Doch warum soll man sich angesichts sinkender Mitgliederzahlen nicht an dem orientieren, was zu Beginn der christlichen Ära praktiziert wurde?
Tatsächlich wird die Unterkirche mit Bischofsgräbern und Kapellen zu Ehren der heiligen Hedwig von Schlesien und des seligen Dompropst Bernhard Lichtenberg im Unterschied zu ihrer früheren Erscheinung vor dem Umbau eine mystisch-dunkle, katakombenähnliche Aura besitzen, die auf viele Besucher anziehend wirken könnte. Nicht nur architektonisch.
Dompropst Przytarski ist für diesen Raum "am dankbarsten".
Ein Aufzug als Serviceleistung
Über den Aufzug, der von der Kirche hierhin führt, werden sich besonders Besucher mit Gehbeeinträchtigung oder Familien mit Kinderwagen freuen.
Einen derartigen Service gibt es beim Weg unter die Kuppel nicht - oder nur für die Arbeiter. Sportlich läuft Elena Cenci mit Helm und speziellen Sicherheitsschuhen die schmale Wendeltreppe nach oben, um dort zu erklären, wie unter der sanierten Außenkuppel ("die komplette Dachdämmung wurde erneuert") eine weiße, wabenartige Innenkuppel installiert worden ist, die dem Innenraum eine fast schon transzendente Helligkeit ohne Kitsch verleiht.
Von hier kann man sich gut die geplanten Sitzreihen für die Gemeinde rund um den Altar vorstellen.
Platziert auf Natursteinplatten, die derzeit noch von Planen, Holzschienen und Baugeröll verdeckt sind.
Dazu passt es, dass auch die Fußbodenheizung der Kathedrale komplett modernisiert wurde.
Dass Taufbecken, Altar und Kuppelöffnung eine Achse bilden, ist kein Zufall, sondern Architektur gewordene Theologie: von der Taufe über die christliche Gemeinschaft am Altar hinauf zum Licht - dadurch soll der christliche Lebensweg versinnbildlicht werden.
Doch etwas Lockerheit gehört auch dazu.
So erläutert Elena Cenci beim Blick auf die Kuppelöffnung, wie das Sonnenlicht im Raum je nach Uhrzeit wandern wird - um schmunzelnd zu ergänzen:
"Es ist eine Art Sonnenuhr, die wir noch dazu bekommen haben."






UNTERNEHMENSINFO


LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 17
Die Menora ist der Siebenarmige Leuchter, der im Jerusalemer Tempel stand.
Der Tempel wurde 587 v. Chr. erst durch babylonischen König Nebukadnezar
und dann endgültig 70 n.Chr. von den Römern zerstört.
Dabei wurde die Menora mit allen anderen Tempelgeräten geraubt und
ist seit dem verschollen.
Die Menora ist neben dem Davidstern ein Wahrzeichen des Judentums.

LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 18
Der Begriff "Tora" wird am Besten mit "(Weg-) Weisung für ein gutes und gerechtes Leben übersetzt".
Die Übersetzung "Gesetz" wird bei uns eher negativ verstanden trifft daher nicht die eigentliche Bedeutung.
1. Das Achtzehngebet (Schemone Esre)
Palästinische Rezension
1. Benediktion, Aboth: Gepriesen seist du, Jahve [unser Gott und Gott unsrer Väter], Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs [großer, mächtiger und furchtbarer Gott], höchster Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, unser Schild und Schild unsrer Väter [unser Vertrauen in allen Geschlechtern]! Gepriesen seist du, Jahve, Schild Abrahams!
2. Benediktion, Geburoth: Du bist ein Held [der Hohe erniedrigt], der Starke [und der die Gewalttätigen richtet], der ewig lebende, der die Toten auferstehn läßt [der den Wind wehen läßt und den Tau herniederfallen], der die Lebenden versorgt und die Toten lebendig macht [in einem Augenblick möge uns Hilfe sprossen]. Gepriesen seist du, Jahve, der die Toten lebendig macht!
3. Benediktion, Qeduschschah: Heilig bist du und furchtbar dein Name, und kein Gott ist außer dir. Gepriesen seist du Jahve, heiliger Gott!
4. Benediktion, Chonen ha-da'ath: Verleihe uns, unser Vater, Erkenntnis von dir her und Einsicht und Verstand aus deiner Tora. Gepriesen seist du Jahve, der Erkenntnis verleiht!
5. Benediktion, Teschubah: Bringe uns zurück, Jahve, zu dir, daß wir umkehren (in Buße); erneuere unsere Tage wie vordem. Gepriesen seist du, Jahve, der Wohlgefallen an Buße hat!
6. Benediktion, Selichah: Vergib uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt gegen dich; tilge [und entferne] unsre Verfehlungen vor deinen Augen weg [denn groß ist deine Barmherzigkeit]. Gepriesen seist du, Jahve, der viel vergibt!
7. Benediktion, Ge'ullah: Sieh an unser Elend und führe unsre Sache und erlöse uns um deines Namens willen. Gepriesen seist du, Jahve, Erlöser Israels!
8. Benediktion, Rephu'ah: Heile uns, Jahve, unser Gott, von dem Schmerz unsres Herzens [und Seufzen und Stöhnen entferne von uns] und bringe Heilung unsren Wunden (Schlägen). Gepriesen seist du, der die Kranken seines Volkes Israel heilt!
9. Benediktion, Birkath ha-schanim: Segne an uns, Jahve unser Gott, [dieses] Jahr [zum Guten bei allen Arten seiner Gewächse und bringe eilends herbei das Jahr des Termins unsrer Erlösung und gib Tau und Regen auf den Erdboden] und sättige die Welt aus den Schätzen deines Guten (deiner Güter) [und gib Segen auf das Werk unsrer Hände]. Gepriesen seist du, Jahve, der die Jahre segnet.
10. Benediktion, Qibbuç galijjoth: Stoße in die große Posaune zu unsrer Freiheit und erhebe ein Panier zur Sammlung unsrer Verbannten. Gepriesen seist du Jahve, der die Vertriebenen seines Volkes Israel sammelt!
11. Benediktion, Haschibah schopetenu: Bringe wieder unsre Richter wie vordem und unsre Ratsherren wie zu Anfang, und sei König über uns, du allein. Gepriesen seist du, Jahve, der das Recht liebhat!
12. Benediktion, Birkath ha-minim: Den Abtrünnigen sei keine Hoffnung und die freche Regierung (= Rom) mögest du eilends ausrotten [in unsren Tagen, und die Nazarener (nozrim = Christen) und die Minim (= Häretiker) mögen umkommen in einem Augenblick], [ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens (der Lebendigen) und mit den Gerechten nicht aufgeschrieben werden]. Gepriesen seist du, Jahve, der Freche beugt!
13. Benediktion, Birkath çaddiqim: Über die Proselyten der Gerechtigkeit (= Ganzproselyten) möge sich dein Erbarmen regen, und gib uns guten Lohn mit denen, die deinen Willen tun. Gepriesen seist du, Jahve, Zuversicht der Gerechten!
14. Benediktion, Boneh Jeruschalajim: Erbarme dich, Jahve unser Gott, [in deiner großen Barmherzigkeit über Israel, dein Volk, und] über Jerusalem, deine Stadt, und über Çion, die Wohnung deiner Herrlichkeit, [und über deinen Tempel und über deine Wohnung] und über das Königtum des Hauses David, des Messias deiner Gerechtigkeit (= deines gerechten Messias). Gepriesen seist du, Jahve, Gott Davids, der Jerusalem erbaut!
15. Benediktion, Schomea' tephillah: Höre, Jahve unser Gott, auf die Stimme unsres Gebetes [und erbarme dich über uns]; denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. Gepriesen seist du, Jahve, der Gebete erhört!
16. Benediktion, 'Abodah: Es gefalle Jahve unserem Gott wohl zu wohnen in Çion, daß deine Knechte dir dienen in Jerusalem. Gepriesen seist du, Jahve, daß wir dir dienen werden in Furcht!
17. Benediktion, Hoda'ah: Wir danken dir, [du bist] Jahve unser Gott [und Gott unsrer Väter], für alles Gute, die Liebe [und die Barmherzigkeit, die du uns erwiesen und] die du an uns getan hast [und an unsren Vätern vor uns; und wenn wir sagten, unser Fuß wanke, hat deine Liebe, Jahve, uns gestützt]. Gepriesen seist du, Jahve, Allgütiger, dir muß man danken!
18. Benediktion, Sim schalom: Lege deinen Frieden auf dein Volk Israel [und auf deine Stadt und auf dein Eigentum] und segne uns alle allzumal.
Gepriesen seist du Jahve, der den Frieden schafft!
LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 19
Die Torarollen bekommen einen speziellen Mantel und werden in den Synagoge im Toraschrein aufbewahrt.
Der Tora-Mantel soll die Torarollen schützen und verschönern.
Er ist aus kostbarem Stoff.

LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 20
Torarollen, die unleserlich und somit unbrauchbar geworden sind, werden feierlich eingemauert und beerdigt.
Es wäre undenkbar, eine Torarolle einfach wegzuschmeißen.

LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 21
Die Mesusa ist ein kleines Kästchen aus Holz, Metall oder Keramik, das am Türrahmen angebracht wird.
In der Mesusa befindet sich ein Pergamentröllchen mit den beiden Weisungen aus der Tora für die Mesusa. Auf dessen Rückseite steht das Wort "Schadaj" ("Allmächtiger").
Eine Mesusa erinnert, dass die Tora auch zuhause im Privaten gilt.

LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 22
Die Tefillin sind Gebetsriemen aus Leder mit Gebetskapseln.
Sie werden während des Morgengebets um den Linken Oberarm (nahe am Herz)
bis zur Hand und um den Kopf gewickelt.
Die Gebetskapseln erhalten zentrale Texte der Tora, z.B. das jüdische Glaubensbekenntnis (das Schma Israel)


LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 23
Der Tallit ist der Gebetsmantel.
Der Tallit ist ein großes Tuch, meist weiß mit schwarzen Streifen am Rand, das um die Schultern gelegt wird (Gott beschützt).
An den vier Ecken des Tallit befinden "Schaufäden" (Zizit) - lange, weiße, mehrfach geknotete, Wollfäden.
Die Zahl ihrer Knoten und Fäden weisen auf die 613 Ge- und Verbote der Tora hin.
Sie erinnern an den Auftrag, nach Gottes Geboten zu leben.

LERNKARTEI RELIGION - JUDENTUM 24
Das jüdische Glaubensbekenntnis ist das Schma Israel:
"Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all Deiner Kraft." (5.Mose 6,4f)
Es wird z.B. nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen und mehrfach im Synagogengottesdienst gesprochen und gebetet.












.webp)


















SPORTFORUM BERLIN
Sportforum Berlin: Vergangenheit, Gegenwart und offene Zukunft
Mit seiner Geschichte als Olympiastützpunkt der DDR und seiner aktuellen Rolle als Zentrum des Leistungssports bleibt das Sportforum Berlin in Alt-Hohenschönhausen ein unverzichtbarer Bestandteil der Berliner Sportlandschaft.
Doch die Pläne für eine Modernisierung des Areals kommen nur kleinteilig voran, der vom BFC Dynamo geplante Neubau eines drittligatauglichen Stadions wird derzeit zwar untersucht, steht aber ebenfalls in den Sternen.
Neben dem Olympiapark im Charlottenburg-Wilmersdorfer Ortsteil Westend verfügt Berlin über ein weiteres bedeutendes Sportareal:
das Sportforum Berlin im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen des Bezirks Lichtenberg, im Nordosten der Stadt gelegen.
Beide Standorte dienen als Wettkampf- und Trainingsstätten für den Leistungs- und Spitzensport.
Das Sportforum Berlin in Alt-Hohenschönhausen ist sogar Olympiastützpunkt für Berlin mit zahlreichen Bundes- und Landesstützpunkten und zählt zu den größten Leistungssportzentren Deutschlands.
Sportforum in Hohenschönhausen: Sportförderung und vielfältige Nutzung
Neben dem Leistungssportzentrum betreibt die Humboldt-Universität hier das Institut für Sportwissenschaften. Außerdem befinden sich an diesem Standort die Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport sowie das Zentrum für Gesundheitssport Berlin.
Es passiert also viel in Alt-Hohenschönhausen – nicht nur im Leistungssport, wo regelmäßig internationale Sportevents stattfinden, sondern auch im Schul-, Breiten-, Freizeit- und Hochschulsport.
Dieses Angebot an Ressourcen gilt es langfristig zu sichern, nicht nur wegen des hohen Bedarfs an Sportstätten in Berlin, sondern auch perspektivisch für die nächsten Jahre.
Hauptnutzer des Sportforums ist der Olympiastützpunkt Berlin, die Dachorganisation der Bundesstützpunkte und damit der größte Stützpunkt in Deutschland.
Zahlreiche moderne Sportanlagen und Trainingsstätten sind im Sportforum Berlin gebündelt
Grundlage dafür sind zahlreiche moderne Sportanlagen und Trainingsstätten, die insgesamt über dreißig Vereinen sowie dem Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Elitesportschule SLZB) zur Verfügung stehen.
Die Nachfrage nach verfügbaren Trainings- und Wettkampfstätten steigt stetig, ebenso wie die Anforderungen an Trainingsmethoden durch neue sportmedizinische Erkenntnisse.
Der Berliner Senat hat daher beschlossen, die Sportanlagen im Sportforum Berlin langfristig durch Modernisierungen oder Neubauten zu erweitern und weitere Anlagen für zukünftige olympische und paralympische Sportarten zu errichten.
Masterplan und Architektenwettbewerb zur Modernisierung des Sportforums
Im Jahr 2021 fand ein Architektenwettbewerb statt, der einen Masterplan für die Umgestaltung des 45 Hektar großen Sportforums erarbeitete.
Ziel war es, das Areal neu zu gliedern und durch Umnutzungen und Neubauten zusätzliche Angebote für den Breiten- und Freizeitsport zu schaffen, ohne den Leistungssport zu beeinträchtigen.
Bisher ist von den ambitionierten Plänen auf dem Gelände jedoch nur wenig zu sehen, doch laut Senatsverwaltung für Inneres und Sport wird sukzessive an der Modernisierung des Areals gearbeitet.
Einige Punkte aus dem Masterplan für das Sportforum Berlin sind bereits umgesetzt worden, weitere befinden sich in Vorbereitung.
So wurde etwa eine Kalthalle für die Wintersportarten errichtet und in Betrieb genommen. Eine Typensporthalle kann zudem seit 2022 genutzt werden, eine weitere Typensporthalle ist geplant.
Zudem seien der Neubau einer Athletikhalle Wintersport sowie der Neubau einer Bogensporthalle in Vorbereitung.
Historische Bedeutung des Sportforums Berlin: Aufbau seit 1954
Das Sportforum Berlin am Weißenseer Weg in Lichtenberg wurde ab 1954 mit 35 Sportstätten errichtet, etwa 20 Jahre nach dem Bau des Olympiaparks im Westteil der Stadt.
Es sollte eine Ost-Berliner Alternative zum Olympiastützpunkt Charlottenburg sein und wurde in den folgenden Jahren als Olympiastützpunkt der DDR etabliert.
Das Areal steht bereits seit 1970 unter Denkmalschutz und umfasst drei Eissporthallen, zwei Turnhallen, ein Fußballstadion sowie weitere Sportanlagen für Leichtathletik, Handball, Volleyball und viele weitere Sportarten.
Für viele Jahre war das Areal auch sportliche Heimat des heutigen DEL-Clubs Eisbären Berlin, ursprünglich SC Dynamo Berlin.
Leistungs- und Breitensport im Sportforum Berlin vereint
In den frühen Jahren war der SC Dynamo Berlin im Grunde der Hauptnutzer des Areals. Heute trainieren hier rund 300 Bundeskaderathleten und 800 Landeskaderathleten.
Hinzu kommen das „Haus der Athleten“ mit etwa 200 Internatsplätzen und das Institut für Sportwissenschaften der Humboldt-Universität mit rund 500 Studierenden.
Auch bekannte Sportvereine wie der BFC Dynamo, die Junioren der Eisbären Berlin und des SC Berlin nutzen die Anlage.
Bemerkenswert ist, dass die DDR-Funktionäre das Sportforum früher traditionell nutzten, um vor internationalen Wettkämpfen ihre Athleten quasi zu verabschieden.
Das Fußballstadion im Sportforum: Geschichte und ungewisse Zukunft
Das Fußballstadion im Sportforum wurde 1959 fertiggestellt und diente dem BFC Dynamo sowie seinem Vorgänger, der SG Dynamo Berlin, als Heimspielstätte.
Es bot Platz für 12.400 Zuschauer, davon 2.400 Sitz- und 10.000 Stehplätze. Bei größeren Spielen, wie im UEFA-Pokal 1973 gegen den FC Liverpool, wurde das Stadion erweitert.
Nach der Wende spielte der BFC Dynamo zeitweise im Stadion des Sportforums, bevor er in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark umzog.
2020 musste der Verein aufgrund des geplanten Stadionabrisses in Prenzlauer Berg zurück ins Sportforum nach Alt-Hohenschönhausen ziehen.
Pläne für den Ausbau des Stadions im Sportforum Hohenschönhausen
Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD aus dem Jahr 2023 wurde der Ausbau des Fußballstadions im Sportforum als nationales Spitzensportzentrum vereinbart.
Damit besteht die Chance, das Stadion drittligatauglich auszubauen, vorausgesetzt, der BFC Dynamo schafft den Aufstieg in die 3. Liga.
Der Standort wäre ideal, da es keine Anwohner gibt, die bei Heimspielen gestört würden, und die Zuschauerströme gut zu lenken wären.
Trotz dieser Aussicht gibt es derzeit Widerstand, da im Sportforum ein „gleichberechtigtes Nebeneinander von Breiten- und Spitzensport“ gewahrt werden soll.
Dennoch bleibt vor allem bei den Fans des BFC Dynamo und bei der Vereinsführung die Hoffnung bestehen, dass der Stadionausbau eine Zukunft hat, insbesondere wenn der Verein sportlich erfolgreich ist.




.jpg)
Psalm 16
Das schöne Erbteil
1 Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich. / 2 Ich habe gesagt zu dem HERRN: Du bist ja der Herr! Ich weiß von keinem Gut außer dir. 3 An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen. 4 Aber jene, die einem andern nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern noch ihren Namen in meinem Munde führen. 5 Der HERR ist mein Gut und mein Teil; du hältst mein Los in deinen Händen! 6 Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land; mir ist ein schönes Erbteil geworden. 7 Ich lobe den HERRN, der mich beraten hat; auch mahnt mich mein Herz des Nachts. 8 Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. 9 Darum freut sich mein Herz, und meine Seele ist fröhlich; auch mein Leib wird sicher wohnen. 10 Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. 11 Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.


16 - ORTE SEINES WIRKENS Berlin, Ostdeutschland, Westdeutschland, Süddeutschland, Schweiz, Österreich, Internet Zielmarkierungen - DEUTSCHLAND - ISRAEL - DUTCH - Königinnen - Lena - Gal - Maxima Mingze - Selena - Christina - Aurora - Charlene - Letizia - Charlize - Olympia - Avril - MARIYA Powered by VoIP - EASYBELL - 1&1 - GALILEO SYSTEMS - Babelsberg Film Studios - Copyright © 2025
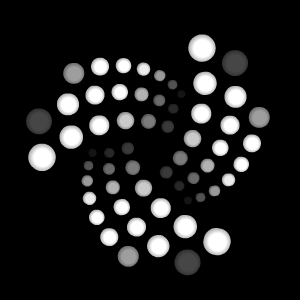
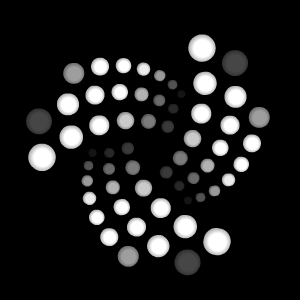





.jpg)

.jpg)





















































































