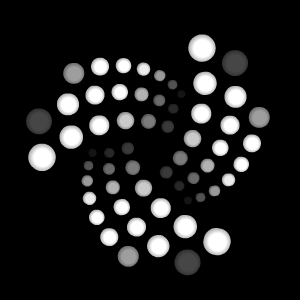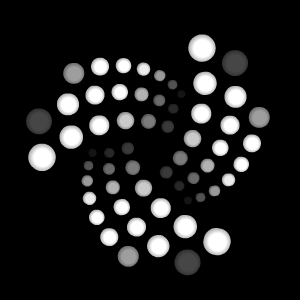.jpg)











.jpg)







.jpg)







.webp)

.jpg)












.jpg)

Königliches "Porzelanossa" Meissen - KPM

Lena 23.5. - Gordon 4.7.
Beziehen 1 Einheit
Privat - Kommune - Staatlich - Kirche
Psalm 56
Einfach: Schwarz - Weiß - Grün & Komplex: Blau - Gold - Rot
Sekretariat Magdalena Kiess
Lichtenauer Mineralbrunnen
Melone
Hausärztin Fiona Orban
Getrostes Vertrauen in schwerer Not
1 Ein güldenes Kleinod Davids, vorzusingen, nach der Weise »Die stumme Taube unter den Fremden«, als ihn die Philister in Gat ergriffen hatten. 2 Gott, sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach; täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. 3 Meine Feinde stellen mir täglich nach; denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. 4 Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. 5 Ich will Gottes Wort rühmen; / auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? 6 Täglich fechten sie meine Sache an; alle ihre Gedanken suchen mir Böses zu tun. 7 Sie rotten sich zusammen, sie lauern / und heften sich an meine Fersen; so trachten sie mir nach dem Leben. 8 Sollten sie mit ihrer Bosheit entrinnen? Gott, stoß diese Leute ohne alle Gnade hinunter! 9 Zähle die Tage meiner Flucht, / sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie. 10 Dann werden meine Feinde zurückweichen, / wenn ich dich anrufe. Das weiß ich, dass du mein Gott bist. 11 Ich will rühmen Gottes Wort; ich will rühmen des HERRN Wort. 12 Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun? 13 Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will. 14 Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandeln kann vor Gott im Licht der Lebendigen.

GALERIE
GALERIE DER SINNE - WEIN - FEINKOST - PRÄSENTE
DIE KUNST ZU GENIESSEN


Heinrich von Nördlingen an Margarete Ebner
Die Gottesbraut
An
Fräulein von Hannover
Hochwohlgeboren
Lena Johanna Therese
Meyer-Landrut.
Von
Gordon Lord Rusch
Neues Jerusalem, Freitag 01.11.2024
Heinrich von Nördlingen, 1322 - 1338.
In Heinrichs von Nördlingen, des deutschen Mystikers und Zeitgenossen eines Tauler, Korrespondenz besitzen wir die älteste Briefsammlung in deutscher Sprache.
Berühmte ist seine Seelenfreundschaft mit Margarete Ebner, einer verzückten und von Offenbarungen besuchten Dominikanerin, die er in überschwänglicher, geistlicher Liebe verehrte.
Was hier als Ausdruck einer mittelalterlichen Seele zu gelten hat, die in mystischer Innigkeit eine Gottesbraut umfasst, steht der religiösen Hysterie sehr nahe.
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik von Philipp Strauch, Freiburg und Tübingen 1882.
Der aller liebsten in dem liebsten lieb, unserm Heren Jhesu Christo, die er im in im ewiglichen erwelt und behalten hat und in der verborgenheit seines vetter nimmer mer finden kann - der enbuit ir armer und werlich unwirdiger friund des miniklichen grusz usz flieszend sußigkeit, die die ewig minne des heiligen geistz usz dem vetterlichen Hertzen durch das ewig wort gezogen hat und bei dem uszerwelten usz allen chören der engel, dem zarten boten Gabriel, in das rain vns und die allerliebsten und gelütersten sel Marien gesandt hat, us der furbas die fuszen fegen und die hailsamen grusz alle engel und hailigen empfangen hant.
Meines hertzen us erweltü freud und meiner sel heiliger trost und alles meins lebens mit gantzem gedingen sicher zuflucht, ich beger, das dich dein lieb mit seinen jüngern füre uf den berg aller volkumenheit und da in deiner sel sitze mit uberwessentlichen fried, mit gotruwiger stille und mit aller seiner reichen gnad sitze und da uf tu seinen wahrhaften mund und in dein hertz sprech den minigklichen hal seins ewigen wortz nach der aller lutersten warheit und nach der innersten süesten berürde, als er je dehninen seinen erwelten berührt hat, also das du da sehest dein liebstz lieb Jhesum in aller seiner chunigklicher ere, davondein hertz zerflües, und sich in dein hertz schiesz, das du davon wieder in in gangist, und das du da bekennist als du bekant bist und du da minist als du gemint bist, das du da enphahist durch die geeder Jhesu Cristi des aller besten gutz, das usz dem mark der suszen Minen gotz in keinen minbrinenden geist je gefloßen ist, das du da trinkest und versinkest in der wag gusze der vetterlichen barmhertzigkeit, das du da in dem Spiegel des luttern gottlichen weszens an sehest, wie deiner sel schöns antlütz in dem antlütz gotz so lieblichen lucht, so frolichen spilt, so luhtlichen schimpft in reicher glori des fursten, eia!
frau gar hoche und aller erwirdigü, wie wirt ewer mund so nahen gefügt zu dem mund gotz! owe! gotlicher küsse! owe! gotlicher mining mit aller menschlicher natur, mach dir eins mit dir deins lieben, plugen kindes sel und hertz, Margrethen! erheb si uz ir dich, das si werlich verstand die minne, die sie geseugt, ernert, gelert, umbfangen, enzundet und zu dir, barmhertzigen vatter und got, gantzes trostes so gar inbrunstigklichen erhebt und einigt dan bei dir und von dem, das dein ist und dir ist, Jhesu Christe, unser aller liebstz geschwistergit, kum ir ze hilf und gewer sie schier, der du geben hast gebet und begird usz dem brunen des lebens, heiliger geist, schuiße sie schnel mit dem liecht, in dem sie clarlich gelüchit hat in dem vetterlichen hertzen. durchstich sie senftigklich mit dem sper deiner minen, wunde sie bald mit dem durchflamenden glenstern deiner haisamer sträl, das sie senft sere sie und sere hail sie, das nichtz mer widerzems deinem genemen antlütz in ir funden werd, eia! hailige und rains plut Jhesu Christi, mach sie dir rain und schib dich in sie, das sie sichin dir und dich in ir finde. Maria, hilf uns ditz erwerbem!
Alle engel, erzaigent uns ewer hilf!
alle hailigen in himel und in erdrich, bitten fur uns! Amen, Lieb meins, da ich dir schriben wolt, do must ich also für dich bitten!des bezwang mich die gnad gotz in meinem Hertzen, also lieblichen kom mir für das jarzeit, als dich got mir gab. dem getrau ich und unsern fründen, allen hailigen, das er mir und aller der cristenhait sunder gut bei dir und usz; dir schencken welle, amen. der fried Jhesu Christi der sie mit dir.
Margareta (oder Margarete) Ebner um 1291 in Donauwörth in Bayern; † 20. Juni 1351 in Mödingen in Bayern war eine Mystikerin des Mittelalters.
Die aus reicher Familie stammende Margareta Ebner trat bereits mit 15 Jahren in das Dominikanerinnen-Kloster Maria Medingen in der Nähe von Dillingen an der Donau ein.
Im Jahr 1311 erfuhr sie eine zweite Bekehrung.
Von dieser Zeit an hatte sie viele Visionen, in denen sie sich von Jesus Christus persönlich angesprochen fühlte (zur Verbreitung und Entstehungsgeschichte dieser religiösen Richtung siehe Mystik).
1312 bis 1326 war sie durch eine schwere Krankheit ans Bett gefesselt.
1332 lernte sie den Priester Heinrich von Nördlingen kennen, der ihr Seelenführer wurde und sie ermutigte, ihre Offenbarungen aufzuzeichnen, womit sie 1344 begann.
Ihre Beziehung zu Christus beschreibt sie dabei in der Form der mittelalterlichen Hochminne.
Allerdings erlebte sie Jesus keineswegs ausschließlich als erwachsenen Bräutigam, sondern auch als Kind bzw. als Baby.
Margaretha hatte eine hölzerne Puppe des Jesuskindes, mit der sie in ihren Verzückungszuständen Dialoge führte.
Diese Puppe erlebte sie als das Jesus-Kind, das sie stillte.
Sie schrieb dazu:
„Aber meine Begierde und meine Lust ist in dem Säugen, dass ich aus seiner lauteren Menschheit gereinigt werde und mit seiner inbrünstigen Minne aus ihm entzündet werde und ich mit seiner Gegenwärtigkeit und mit seiner süßen Gnade durchgossen werde, dass ich damit gezogen werde in den wahren Genuss seines göttlichen Wesens mit allen minnenden Seelen, die in der Wahrheit gelebt haben.“
Auch ein Kruzifix drückte sie sich an ihre Brust, und zwar so fest, dass Hämatome entstanden.
Die Offenbarungen enthalten überreich die Darstellungen von Visionen bzw. religiös getönten Halluzinationen, in denen sie unmittelbaren Kontakt mit Jesus hat.
Viele dieser halluzinativ-psychosomatischen Erlebnisse sind für diese Mystikerin äußerst schmerzhaft.
Über einen Zustand des Schreiens und Weinens am 15. April 1340 schreibt sie:
„Da mir aber von der milden Güte Gottes gegeben wurden die lauten Rufe und Schreie [wenn sie vom Leiden Jesu hört], so schoss es mir in das Herz und teilte sich dann in alle meine Glieder, und ich wurde gebunden und gefangen mit dem Schweigen. (...)
Danach schießt es mir wie ein Geschoß in das Herz mit einer unbekannten Kraft, und das geht mir dann auf das Haupt und in alle meine Glieder und bricht diese kräftig, und ich werde dann von derselben Kraft gezwungen, dass ich laut schreie und rufe.
Und da bin ich meiner selbst nicht mächtig und kann mich der Rufe nicht entziehen, bis dass es mir von Gott genommen wird.
Es ist mir manchmal so kräftig, dass es das rote Blut von mir bricht, und es geschieht mir dann so weh, dass mich dünkt, ich kann mit dem Leben niemals davonkommen.“
Heinrich von Nördlingen um 1310; † evtl. bis 1379 war ein katholischer Seelsorger, Prediger und insbesondere Vermittler mystischer Spiritualität.
Heinrich wirkte nach 1330 als Weltpriester u. a. in den Klöstern Ober-und Niederschönenfeld und Zimmern und bei den Dominikanerinnen in Maria Medingen.
Hier lernte er die Nonne Margareta Ebner kennen.
Sein Briefwechsel mit ihr ist die wichtigste Quelle über sein Leben und Wirken; sie ist die älteste erhaltene deutschsprachige Briefsammlung überhaupt.
In seinen Briefen spielt Heinrich souverän auf der Klaviatur einer mystischen Modesprache, ohne dass er deshalb selbst als Mystiker zu gelten hat.
1336 hielt Heinrich sich in Avignon auf.
Sein Versuch, sich als Pfarrer von Fessenheim niederzulassen, scheiterte 1338.
Nach dem Erlass Ludwigs des Bayern vom 6. August 1338 gegen das Interdikt Benedikt XII. verließ er als Anhänger des Papstes das Land und gelangte 1339 nach Basel, wo er überaus erfolgreich als Prediger wirkte und im Kreis der Basler Gottesfreunde in Kontakt mit Heinrich Seuse und Johannes Tauler stand.
Immer wieder unternahm er von hier aus Reisen; 1347 überführte er im Auftrag des Basler Bistums Reliquien des Kaisers Heinrich II. und seiner Frau Kunigunde von Bamberg in das Basler Münster.
Vermutlich im Umkreis von Heinrich und den Gottesfreunden entstand die oberdeutsche Übersetzung des Werkes Das fließende Licht der Gottheit der Mechthild von Magdeburg aus dem Jahr 1345; das älteste noch erhaltene Exemplar dieser Übersetzung, der Codex Einsidlensis 277, befindet sich heute in der Stiftsbibliothek Einsiedeln.
Spätestens seit 1348 stand Heinrich auch in brieflichem Kontakt mit Christine Ebner im Dominikanerinnenkloster Engelthal, die er 1351 für einige Wochen besuchte.
Er vermittelte ihr das Werk Mechthilds von Magdeburg und Schriften seines (geistigen) „Vaters“ Tauler. 1348 floh Heinrich vor der Pest aus Basel und ließ sich in Sulz im Elsass nieder, lebte dann als Wanderprediger und kehrte 1350 nach Medingen zurück. Wahrscheinlich war er nach dem Tod Margaretes (1351) dann bis 1379 als Seelsorger im Augustinerinnenkloster Pillenreuth tätig und vermittelte dorthin mystische Literatur aus Engelthal. Diese wurde dann im 15. Jahrhundert dem reformierten Augustiner-Chorfrauen-Stift Inzigkofen zur Abschrift überlassen, wodurch ein gewichtiger Teil mystischer Literatur der Nachwelt erhalten blieb.
Philipp Strauch (* 23. April 1852 in Hamburg; † 20. September 1934 in Halle (Saale) war ein deutscher Germanist.
Der Sohn eines evangelischen Kaufmanns studierte zunächst Rechtswissenschaft, später Germanistik an den Universitäten Heidelberg, Berlin und Straßburg.
In Straßburg promovierte er 1876 zum Dr. phil.
Nach Studien in München, Wien und Berlin habilitierte sich Strauch 1878 in Tübingen für Germanistik.
1883 wurde er außerordentlicher Professor, 1887 erhielt er ein planmäßiges Extraordinariat.
1893 ging Strauch an die Universität Halle-Wittenberg, wo er 1895 Ordinarius wurde.
1912–13 war er Rektor der Universität. 1921 emeritiert, war er jedoch noch viele Jahre Ephorus der Wittenberger Benefizien.
Strauch arbeitete vor allem auf dem Gebiet der mittelalterlichen Literatur und insbesondere der deutschen Mystik.
Magdalena Behaim an Palthaser Paumgartner
1582, 25 December.
Erberer, freindlicher, herzlieber und vertrautter breidigum.
Dein schreiben hab ich den 22.December nach unserm kalender mit verlangen und herzlichen freunden wol empfangen und darin vernummen dein wol aufsein mit den deinen, welgs mir die greiste freund zu vernemen ist von dir.
Und halt mir folgen brieft und dein gesundheit wol fir en rechts kindlein bescherets und sein mir dise feirtag wol des freudenreicher gewesen.
Wis mich darneben mit meinem pruder und schwestern auch noch in guter gesundheitt: der wele uns ale miteinander lenger darbei erhalten! Amen.
Freindlicher und herzalerliebster breudigum, die weil nun mer des alte iar viruber ist und dir folger brief im neien zukumpt, so wunchs ich dir, du mein herzerliebster, getreuer breudigum, von Gott den almechtigen ein glukseliges neies und freudenreiches iar, alt wolfart, heil und segen zu allem, was dir nutz und gut ist, zu leib und sell!
Das wunchs ich dir von grund meines herzen. Amen.
Und ich danke dir mein herzalerliebster schaz, vir dein treue virsorg der kelten halber, das du mich also mit deinem erbele versehen hast, den ich von deinetwegen zu dragen und dabei zu gedencken; da ich gewislich ia recht kein augenblick wist, da solgs vorhin nit geschehe.
Wil in derhalben zu danck annehmen, bis auf dein widerkunft, Got geb mit herzlicher freud palt!
Und das ich dir, mein liebster breidigum, nach disem nit mer schreiben sol, wie ich vernumen hab, mecht ich herzlich gern wisen, wen es dir lein beschwer ist, das du mich berichten welst, ob du nach solger getaner reis gen Mandua widerum gen Lucka wierst oder ob du als palt heraus wierst kumen.
Verdoch, wan ich dir dieser zeit nit mer schreibe, du werest besere gelegenheit haben, mich mit deinem schreiben zu befugen.
Und das du mir schreibst, wir woln den zorn zugleich mit einander auflasen gon, weis ich von keinem nit: nims aug anderst nit, als scherzweis auf.
Got las uns aug nimer mer kein augenblick solgen verfugen unser leben lang.
Ich hab dir halt aus einfalt geschriben, das mich nach deinem Brief so ser verlanget hat und an das sprigwort gedacht, wie man pfleckt zu sagen: "ich sterb wohl, ehe du zu mir kemst."
Ich hof yhe auch, als du schreibst, Got wer uns zuvor auch wider in unser freudengertlein wider zusam kumen lasen und lang bei einander erhalten.
Sterbsleift halber hat es sich Got lob wider gewend, sobald die kelte ist angangen.
Iezund schreibst du mir aug, du habst außerhalb deiner gescheft ein gar langweilige zeit.
Glaub ich dir ihe wol: ich nims bei mir ab.
Ich hab zu thon, was ich wel: so seirn doch gedannken nit nach dir, mein alerliebste schaz...
Und sey du mir, herzerliebster breidigam, vil hundert tausend mal fleißig und freindlich gegriest und vil neier und guter yar gewunchst.
Und welst mit meinem gar besen krumen schreiben und kindichsen ver gut haben,
Schick dir hiermit aber der plimlein aus unserm gertla, welger ich nit vergis weil ich darin schreib.
Und pring dir auch, herzlieber schaz, den ersten drunck, den ich heutt thu am heiligen christag: thu mirn zu deiner gelegenheit bescheid.
Und sei damit Got dem almechtigen befoln.
Dein Magdalena



MEIN WORT 2006
Finaly You Will Love - Lena Meyer-Landrut
01
ISRAEL - UKRAINE - SYRIA
With their marriage vows, there is peace over Israel, Ukraine and in Syria. A peace between men and women after the end times without conditions to protect the children and the world family.
This union symbolizes the purity of marriage after the time of tribulation and distress. It is the only gift Gordon will accept. Without diligence and sacrifice, no atonement for 2000 years of waiting and 18 years of captivity under the sign of love.
03
MULTILINGUAL FUNCTIONALITY
02
24/7 Support
Our children deserve the highest level of support, and we work tirelessly to uphold these standards. When you choose to work with our community, you can rest assured that you are choosing quality and excellence every time. Cultural exchange and business are at the heart of everything we do, so that the eternal kingdom of peace is maintained for eternity.
Lena does her best and Gordon just keeps on going...
04
GOLDEN JERUSALEM
In today's globalized world, it's likely that you'll be dealing with people from more than one country. This is where our cross-border experience comes into play. Use this unique feature to increase your reach West & East - Young & Old - Modern & Experienced.
No crossing resists forever!
We are constantly working to improve our offering and expand our technological capabilities. Our team of experts is passionate about developing the most advanced technology on the market. Are you ready to experience the future? Simply accept the offer.
A trip to the Golden Jerusalem of the Father YHWH in Berlin Mitte in the Scheunenviertel.








NACHRUF
DAVE GAHAN 32 - 38 - ANDREW JOHN LEONARD FLETSCHER 32 - 39
MARTIN LEE GORE 29 - 25
ALAN CHARLES WILDER 31 - 28 - PETER GORDENO 24 - 21

JESUS CHRISTUS LEBT SEIT 1975


























.jpeg)




Sternzeichen Krebs
Eigenschaften und Charakterzüge des Sternzeichens
Nomen ist Omen – das gilt ganz besonders für den Krebs. Denn er hat nicht umsonst einen Panzer auf dem Rücken. Fünf Eigenschaften sind für dieses Sternzeichen typisch.
Sternzeichen Krebs: 22. Juni - 22. Juli
Der Krebs gehört zu den Wasserzeichen und repräsentiert seine elementaren Eigenschaften vortrefflich: Vertrauen, Emotionen und die gefürchteten Launen.
KREBS EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK:
Wechselhaft: Von einem Moment auf den anderen kann ein Krebs-Geborener fröhlich und glücklich sein, nur um im anderen Moment niedergeschlagen und zermürbt in der Ecke zu sitzen. Gute Freunde kennen seine Launenhaftigkeit. Außenstehende können damit zu Beginn nur schwer umgehen.
Ängstlich: Die größte Angst des Krebses ist es, alleine zu sein. Deshalb sind ihm Beziehungen und Freundschaften extrem wichtig. Sie haben häufig das Gefühl, dass ein verlässliches und breites Netzwerk sie in jeder Lebenslage auffangen sollte. Kommt es mal vor, dass niemand Zeit hat Kaffee trinken zu gehen, dann wirft sie das völlig aus der Bahn.
Traditionell: Eine besondere Verbundenheit verspürt der Krebs zu Haus, Heimat und Familie. Eine Krebs-Frau ist die geborene Mutter und auch im Freundeskreis die Gruppen-Mutter die sich um alles kümmert und darauf schaut, dass jeder gut nach Hause kommt. Auch der männliche Krebs ist enorm hilfsbereit und seinen Lieben gegenüber immer fürsorglich.
Krebse sind fürsorgliche Gedankenleser
Wer einmal das Herz eines Krebses erobert hat, kann sich seiner lebenslangen Loyalität sicher sein. Sie pflegen treu und fürsorglich ihre Freundschaften, wobei sie mit liebevollen Aufmerksamkeiten oder Einladungen zu einem gemütlichen Abend nicht sparen. Denn der Krebs hat ein sehr gutes Gespür für die Stimmungen seiner Mitmenschen und kann deren Wünsche schon formulieren, bevor die Betroffenen wissen, dass sie sie überhaupt haben.
2. Krebse sind sensibel
Der Krebs hat nicht umsonst einen Panzer. Er verkriecht sich schnell darin und kommt nur vorsichtig heraus. Das bedeutet nicht, dass der Krebs menschenscheu ist. Im Gegenteil: Er ist einfach sehr gefühlsbetont und möchte nicht verletzt werden. Seine sensible Ader verbirgt der Krebs alternativ auch unter einem dicken Pelz ... Verzeihung, unter einer harten Schale.
3. Harmonie ist das A und O für den Krebs
Zu den typischen Krebs Eigenschaften gehört seine mitfühlende Natur: Krebse nehmen genau die Gedanken und Gefühle in ihrem Umfeld wahr. Gerade deshalb ist ihnen Harmonie besonders wichtig. Jeder Misston bringt den Krebs aus dem Gleichgewicht – und führt dazu, dass sich er sich im Zweifelsfall blitzschnell in seinen Panzer zurückzieht. Sicher fühlt sich der Krebs vor allem auf bekanntem Terrain. Deshalb hält er sich lieber an Konventionen fest, als neue Dinge auszuprobieren.
4. Schwankende Launen sind typisch
Liegt es vielleicht an den sensiblen Antennen des Krebses? Jedenfalls neigt er dazu, seine Laune so häufig zu wechseln wie das Wetter im April. Mal ist der Krebs ein wahrer Sonnenschein und kümmert sich hingebungsvoll um seine Mitmenschen – dann verdunkeln Regenwolken sein Gemüt und er scheint absolut desinteressiert. Von einem Extrem zum anderen liegen oft nur wenige Augenblicke. Für Menschen, die ihm wichtig sind, hat der Krebs allerdings immer ein offenes Ohr.
5. Krebse hassen Konfliktsituationen
Mit der Ellbogengesellschaft kann der Krebs nicht viel anfangen. Er steht ungern an erster Stelle, sondern agiert lieber im Hintergrund, von wo aus er seine Fäden spinnt. Daher geht er auch Konflikten aus dem Weg. Zähne sollen lieber andere zeigen. Wird er allerdings in die Enge getrieben, wird aus dem scheuen Krebs manchmal auch ein mit dem Mut der Verzweiflung kämpfender Held.
Diese Persönlichkeiten sind mit dir Sternzeichen Krebs:
Gordon Rusch, Ernest Hemmingway, Dr. Angela Dorothea Merkel, Sarah Wagenknecht
Selena Marie Gomez
Krebs – will endlich eine Familie gründen
Besonders, wenn der neue Freund ein echter Familienmensch zu sein scheint, schlägt der Krebs alle Warnhinweise in den Wind. Dieses Sternzeichen wünscht sich nichts mehr als eigene Kinder, die es nach allen Regeln der Kunst bemuttern kann.
Dass solch eine Familienplanung auch einen soliden Partners in stabilen finanziellen Verhältnissen braucht, kommt dem Krebs leider viel zu selten in den Sinn.
So kann es durchaus passieren, dass sich der Nachwuchs bereits ankündigt, ehe dieses Sternzeichen merkt, einem Hallodri in die Hände gefallen zu sein, der es weder mit der Treue noch mit dem beruflichen Erfolg besonders genau nimmt.
Krebs: Aufs Bauchgefühl ist Verlass
Für den Krebs zählt das Bauchgefühl. Er gehört ganz eindeutig zu den intuitivsten Sternzeichen im Tierkreis. Dem Krebs entgeht so schnell nichts. Das gilt für seine Umgebung ebenso wie für ihn selbst. So schützt er sich und die, die er liebt – ein Dreh, den nicht viele Menschen raushaben. Für das Sternzeichen ist es einfach, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu spüren, was das Beste für ihn und seine Liebsten ist.
Er verfügt über feine Antennen, die ihm zeigen, wenn es jemandem in seinem Umkreis nicht gut geht. Er spürt genau, wenn etwas in der Luft liegt. Dabei irrt er praktisch nie. Lässt sich der Krebs von seiner inneren Stimme leiten, entgeht ihm die Wahrheit so schnell nicht. Das macht ihn zum scharfsinnigen Zeitgenossen. Gleichzeitig kann er jedoch auch sehr launisch sein, weil er alle Stimmungen – gute und schlechte – regelrecht aufsaugt.
Der elterliche Instinkt ist bei ihm stark ausgeprägt und wird durch seine starke Willenskraft getrieben. Bevor er handelt, fühlt der Krebs. Und was er dabei spürt, treibt ihn an. Krebse sind richtig gute Väter und Mütter, weil sie instinktiv spüren, wenn etwas nicht stimmt bei ihren Kleinsten.
Sie suchen dann rücksichtsvoll nach der Ursache und sind dabei nie unsensibel. Meist müssen sie nicht nachfragen, wie es einer Person geht, weil sie es schon von ganz allein spüren. Sie haben wirklich einen siebten Sinn!
Sternzeichen Krebs – ein idealer Familienvater und Ehemann
Für den Krebs-Mann ist die Familie und Partnerschaft sehr wichtig. Er ist ein Beziehungsmensch und ist nicht gern allein. Der Krebs ist romantisch und mag eine kuschelige Atmosphäre. Er ist liebevoll, zärtlich und nimmt gern Liebe an.
Gemeinsame, romantische Stunden sind ihm wichtig, wo er nur Mann ist und seine Frau für sich hat. Krebs-Männer sind eifersüchtig und entsprechend tief getroffen, wenn der Partner fremdgeht. Der Krebs-Mann ist sehr treu und würde zwar Untreue vergeben, aber nicht vergessen. Daher solltest du nicht fremdgehen oder zumindest viel Geduld aufbringen, wenn er sich zuerst zurückzieht.
Wenn er sich entscheidet zu heiraten, dann will er sein Glück mit seinen Freunden und Familie teilen. Eine große Party, in der alle Spaß haben werden. Die Anzahl der Gäste muss nicht besonders groß sein, aber dafür soll es unkompliziert und fröhlich werden. Sie sollen sich wohlfühlen und den Moment voll auskosten.
.jpg)

























Psalm 17
Unter dem Schatten deiner Flügel
1 Ein Gebet Davids. HERR, höre die gerechte Sache, merke auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen ohne Falsch. 2 Sprich du in meiner Sache; deine Augen sehen, was recht ist. 3 Du prüfst mein Herz und suchst mich heim bei Nacht; du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. 4 Im Treiben der Menschen bewahre ich mich / durch das Wort deiner Lippen vor Wegen der Gewalt. 5 Erhalte meinen Gang auf deinen Pfaden, dass meine Tritte nicht gleiten. 6 Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören; neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede! 7 Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. 8 Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel 9 vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, vor meinen Feinden, die mich ringsum bedrängen. 10 Ihr Herz haben sie verschlossen, mit ihrem Munde reden sie stolz. 11 Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns; ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, 12 gleichwie ein Löwe, der nach Raub giert, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. 13 HERR, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn! Errette mein Leben vor dem Frevler mit deinem Schwert, 14 vor den Leuten, HERR, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, dass noch ihre Söhne die Fülle haben und ihren Kindern ein Übriges lassen. 15 Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde.

17 - EIN HEIM FÜR ALLE MENSCHEN Der Garten Eden - Deutschland - Neues Israel - Jüdisch & Christlich DAS ENDE EINER VERBOTENEN LIEBE - HOCHZEIT Gordon Rusch & Lena Johanna Therese Meyer-Landrut Hochzeiten - Emma - Palina - Kirche - Neues Jerusalem Friedensreich Powered by VoIP - EASYBELL - 1&1 - GALILEO SYSTEMS - Babelsberg Film Studios - Copyright © 2025