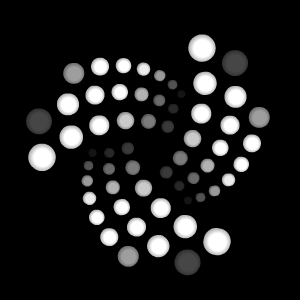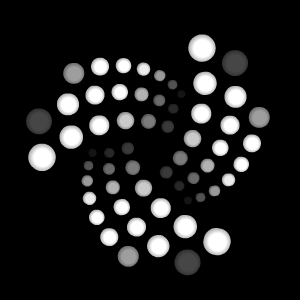„Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des
Pharisäers zu Tisch war; da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und
trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen.
Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl.“ Lk 7, 36 - 50

HEILIGE MARIA MAGDALENA
FRAU DER APOKALYPSE
EIRENE
Lena Johanna Therese Meyer-Landrut
geb. am 23.05.1991 Hannover - Galiläa 2
Mutter: Daniela - Vater: Ladislas
.jpg)
So wuchs die Sängerin und Moderatorin auf
Sie ist Sängerin, Songwriterin und Jurorin bei "The Voice Kids".
Lena Meyer-Landrut ist mittlerweile 34 Jahre alt, supererfolgreich und in der deutschen Medienlandschaft sehr präsent.
Seit sie 2010 für Deutschland mit ihrem Song "Satellite" den Eurovision Song Contest gewann, steht Lena in der Öffentlichkeit. Doch über das Privatleben der Ehefrau von Mark Foster ist kaum etwas bekannt.
Und besonders über die Zeit vor ihrem großen Erfolg mit Stefan Raab an ihrer Seite wissen Fans nur wenig.
Wir haben recherchiert.
Lena spricht über ihr geringes Selbstbewusstsein
Generell wirkt Lena immer gut gelaunt und fröhlich doch ab und an lässt die Sängerin auch ihre nachdenkliche und unsichere Seite durchblicken – so etwa bei ihrem Post zum Neujahr 2024.
"Ich halte generell sehr wenig von mir", und ergänzt, dass sie schon immer ein geringes Selbstbewusstsein gehabt habe.
Zur Erklärung taucht Lena in ihre Kindheit ab und gewährt hier einen seltenen Einblick.
Ihr Vater Ladislav habe die Familie, als Lena ein Jahr alt war, verlassen und Lena sei bei ihrer alleinerziehenden Mutter Dani großgeworden.
Auch ihre Großmutter sei Teil der Erziehung und ihrer Kindheit gewesen.
Diese habe aber – nicht aus Böswilligkeit, sondern aus einem Generationsunterschied heraus – Lenas Unsicherheit geschürt und so trotz der ihr entgegengebrachten Liebe einen negativen Einfluss auf die gehabt. "Ich hab davon 'nen richtigen Hau", erklärt Lena.
Auch wenn die Sängerin wisse, woher sie ihr geringes Selbstbewusstsein habe, so habe sie ihr Kindheitstrauma trotzdem noch nicht überwunden.





HEILIGE GAL GADOT
Gal Gadot Versano
geb. am 3o.04.1991 Petah Tikva - bei Tel Aviv - Israel
Mutter: Irit - Vater: Michael

Dass Israel in puncto schöne Frauen einiges zu bieten hat, weiß man spätestens seit Bar Refaeli.
Wer dann noch zur Schönsten des Landes gekürt werden will, muss sich somit an hohen Anforderungen messen lassen: Gal Gadot erfüllte sie alle und wurde 2004, mit 18 Jahren, zur "Miss Israel" gekürt.
Es war das erste markante Zeichen, dass das israelische Model in der Fashionwelt für sich setzen konnte.
Ihr Auftritt bei der Wahl der "Miss Universe" im gleichen Jahr sicherte ihr noch mehr Aufmerksamkeit. "La Perla Lingerie" oder "Esprit" buchten daraufhin die dunkelhaarige Schönheit als Model für ihre Kampagnen.
Gal Gadot erobert schnell und furios Hollywood
Wirkliches Aufsehen erregte Gal Gadot vor allem, als sie im Jahr 2007 an einer Fotostory über israelische Models in der Armee mitwirkte. Dies brachte dem Model eine der Hauptrollen in der TV-Serie Bubot ein.
Als Gal Gadot 2009 ein Engagement für Fast und Furious – neues Modell. Originalteile erhielt und neben Vin Diesel und Paul Walker auftreten durfte, war ihr Einstieg ins Schauspielfach perfekt.
Es folgten Auftritte in den TV-Serie Entourage und The Beautiful Life sowie in den Blockbustern Knight and Day (2010; mit Tom Cruise und Cameron Diaz) und Date Night – Gangster für eine Nacht (2010; mit Steve Carell, Tina Fey und Mila Kunis).
Aus Gal Gadot wird Wonder Woman
Nach ihrem Einstieg in die Welt der heißen Schlitten gehörte Gal Gadot auch in den Nachfolgern Fast & Furious Five (2011), Fast & Furious 6 (2013) und Fast & Furious 7 zum Cast, der mittlerweile auch mit den Stars Dwayne Johnson, Jason Statham und Kurt Russell erweitert wurde. Allerdings war sie zwischen dem Star-Aufgebot und all den PS-Boliden nur hübsches Beiwerk.
Das änderte sich jedoch 2016 mit der Comic-Verfilmung Batman v Superman: Dawn of Justice, wo sie neben den beiden Protagonisten Ben Affleck und Henry Cavill als Wonder Woman zu sehen ist.
Im Folgejahr bekam sie dann sogar ihren eigenen Film als Wonder Woman (2017; mit Chris Pine und Connie Nielsen) und noch im gleichen Jahr war sie Mitglied der Justice League (2017; mit Ben Affleck, Henry Cavill und Amy Adams), wo sie abermals als Wonder Woman mit einem halben Dutzend weiterer Superhelden für Gerechtigkeit sorgt.



Studienfachbezogene Praktika für ausländische Studierende und Absolventinnen oder Absolventen
Ein studienfachbezogenes Praktikum muss nicht durch die BA genehmigt werden, wenn mindestens einer der folgenden Aspekte zutrifft:
positiv:
Die Praktikantin oder der Praktikant hat die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates oder eines der folgenden Länder: Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz.
positiv:
Das Praktikum findet im Rahmen eines von der EU geförderten Programms wie zum Beispiel Leonardo, Sokrates oder TACIS statt.
positiv:
Die Praktikantin oder der Praktikant kommt ausschließlich in Ihren Betrieb, um eine Abschlussarbeit zu verfassen. Sie oder er übt keine praktische Tätigkeit aus und erwirbt somit keinerlei berufliche Fähigkeiten. In rechtlicher Hinsicht handelt es sich daher nicht um ein Praktikum.
Voraussetzungen
Grundlegende Voraussetzung dafür, dass die BA das Praktikum genehmigt, ist, dass es einen unmittelbaren Bezug zum Studienfach der Praktikantin oder des Praktikanten hat. Außerdem muss Folgendes zutreffen:
Die Studentin oder der Student …
positiv:
ist an einer akkreditierten Hochschule im Ausland eingeschrieben. Als akkreditiert gilt die Hochschule, wenn sie im Informationsportal anabin positiv mit H+ beziehungsweise H+/- gelistet ist.
positiv:
strebt einen Abschluss an, der mit einem Abschluss in Deutschland vergleichbar ist.
positiv:
hat bei Praktikumsbeginn bereits 4 Fachsemester oder mehr abgeschlossen.
Praktikum über eine Austauschorganisation
Es gibt Austauschorganisationen, die Praktika für Studierende beziehungsweise für Absolventinnen oder Absolventen vermitteln. Für Letztere gilt, dass sie ihr Studium spätestens 18 Monate vor Praktikumsbeginn abgeschlossen haben müssen.
Handelt es sich um eine Austauschorganisation, die durch die BA anerkannt ist, stellt diese den Antrag auf die Genehmigung des Praktikums bei der BA.
Im Vorfeld lassen Sie als Arbeitgeberin beziehungsweise Arbeitgeber der Austauschorganisation die erforderlichen Informationen oder Dokumente zukommen. Sie haben somit keinen unmittelbaren Kontakt mit der BA.
Pflichtpraktika
Handelt es sich um ein Pflichtpraktikum, ist eine Bestätigung der Hochschule erforderlich, die Folgendes nachweist:
Die ausländische Schul- oder Studienordnung sieht ein Pflichtpraktikum vor und das Praktikum in Ihrem Betrieb wird von der ausländischen Hochschule als solches anerkannt.
Dauer und Vergütung
Wenn Studierende oder Absolventinnen beziehungsweise Absolventen mehrere Praktika machen, dürfen die Zeiträume in Summe 12 Monate nicht überschreiten.
Praktikantinnen und Praktikanten müssen grundsätzlich mindestens den gesetzlichen Mindestlohn beziehungsweise den tariflichen Branchenmindestlohn erhalten. Ausnahmen hiervon sind im Mindestlohngesetz geregelt. Darüber hinaus gelten für ausländische Praktikantinnen und Praktikanten die gleichen Beschäftigungsbedingungen wie für deutsche Praktikantinnen und Praktikanten.
Genehmigung eines studienfachbezogenen Praktikums:
Ablauf
Ohne Bestätigung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) ist ein Praktikum nicht gestattet. Stellen Sie den Antrag daher rechtzeitig, jedoch frühestens 6 Monate vor Praktikumsbeginn.
Absolvieren Studierende oder Absolventinnen beziehungsweise Absolventen mehrere Praktika, muss für jedes Praktikum ein neuer Antrag gestellt werden.

HEILIGE MARIA VON MARBURG
MARTHA - MARIA VON BETHANIEN
Lena Johanna Gercke
geb. am 29.02.1988 Marburg - Galiläa 2
Mutter: Elvira - Vater: Uwe

Lena Johanna Gercke ist ein deutsches Model und Fernsehmoderatorin.
Sie gewann 2006 die erste Staffel von Germany’s Next Topmodel und
moderierte von 2009 bis 2012 die ersten vier Staffeln von Austria’s Next Topmodel.
Karriere
Im August 2004 wurde Gercke auf einem regionalen Casting für eine Fastfood-Kette entdeckt und anschließend für Fotoshootings und den Laufsteg gebucht. Anfang 2006 nahm sie an der ersten Staffel der vom Fernsehsender ProSieben ausgestrahlten Castingshow Germany’s Next Topmodel teil.
Am 29. März 2006 wurde sie zur Siegerin des Wettbewerbs gekürt, erhielt einen Vertrag mit der Modelagentur IMG Models und erschien auf dem Titelbild der Deutschlandausgabe der Cosmopolitan.
Gercke machte unter anderem Werbung für Oui Set, Windows Live und Katjes.
Sie zierte verschiedene Cover von deutschen und internationalen Magazinen.
Anfang 2009 lief sie zum dritten Mal für verschiedene Designer auf der Berlin Fashion Week.
Ihr Vertrag mit IMG Models endete 2010.
Der Vertrag mit ONEeins wurde 2012 aufgelöst.
Von 2009 bis 2012 moderierte sie Austria’s Next Topmodel bei Puls 4; am 11. April 2013 erstmals das ProSieben-Magazin red!.
2013 und 2014 saß sie in der Sendung Das Supertalent neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Guido Maria Kretschmer in der Jury.
Im August 2015 moderierte sie bei ProSieben die Show Prankenstein und zeigte mit versteckter Kamera gefilmte Streiche.
Seit Herbst 2015 moderiert sie zusammen mit Thore Schölermann die Castingshow The Voice of Germany.
Im November 2016 moderierte sie die Tanzshow Deutschland tanzt.
Im Mai 2017 trat sie bei der ProSieben-Spielshow Schlag den Star gegen Lena Meyer-Landrut an, der sie nach sechs Stunden und 15 Spielrunden unterlag.
Ebenfalls im Mai 2017 wurde sie mit dem About You Award in der Kategorie Fashion ausgezeichnet.
2017 hatte sie im Film Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf eine Rolle als Synchronsprecherin der Schlumpfblüte.
Seit Februar 2018 ist sie Teil der Expertenjury in der Erfindershow Das Ding des Jahres auf ProSieben.
Seit 2019 hat sie bei About You ihre eigene Modemarke LeGer by Lena Gercke.
Im März 2020 war Gercke auf dem Cover des Wirtschaftsmagazins Forbes.
2019 sowie 2021 war Gercke Gastjurorin bei Germany’s Next Topmodel.

Jesus sagte einmal (Mt 8,20): „Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ Er erklärte seinen Jüngern auch, dass wenn sie bereit sind, Häuser und Äcker um seinetwillen und um des Evangeliums willen aufzugeben, dann werden sie es hundertfältig wieder empfangen, in diesem als auch im zukünftigen Leben (Mk 10,29-30).
Obschon Jesus kein Haus besass, hatte er viele Häuser im ganzen Land zerstreut, in denen er aufgenommen wurde. Z. Bsp. das Haus der Schwiegermutter des Petrus in Kapernaum. Z. Bsp. das Elternhaus in Nazareth. Z. Bsp. das Haus Marthas in Betanien. Betanien lag etwa 4 Kilometer westlich von Jerusalem.
Martha und Maria waren Schwestern und treten bei drei bekannten Ereignissen auf: Bei einer Mahlzeit (Lk 10,38-42). Bei der Auferweckung ihres Bruders Lazarus (Joh 11,1-46). Bei einem Gastmahl, als Maria die Füsse Jesu salbte (Joh 12,1-9).
Welches Ereignis kommt uns in den Sinn, wenn wir den Namen Martha hören? Denken wir daran, als Martha gläubig bekannte: „Ja, Herr, jetzt glaube ich, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt“? (Joh 12,27). Denken wir daran, als Martha die Gemeinschaft mit Jesus genoss, zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Bruder? (Joh 12). Ich vermute, dass die meisten an das Ereignis denken, als Jesus sie zurechtwies, weil sie sich zu sehr um materielle Dinge kümmerte, statt um geistliche Werte. So sind wir Menschen oft: Wir erinnern uns zu leicht an die negativen Dinge im Leben. Die positiven Ereignisse vergessen wir leider all zu schnell. Dabei gibt es von Martha in der Bibel eine ganz andere Seite zu entdecken.











HEILIGE PALINA ROSCHINSKAJA
Palina Rojinski - Heilige Russlands
geb. am 21.04.1985 Leningrad/St.Petersburg
Göttin der Gerechtigkeit
.webp)
Polina Roschinskaja wandert 1991 zusammen mit ihren Eltern von der russischen Stadt St. Petersburg nach Berlin aus. Sie macht Abitur, beginnt Literatur zu studieren, wird Moderatorin bei MTV – und bleibt beim Fernsehen. Nach einigen Jahren als Sidekick von Joko & Klaas wird sie immer häufiger auch solo als Moderatorin engagiert und startet parallel eine Karriere als Filmschauspielerin. 2020 ist sie gleich in zwei Kinofilmen zu sehen. 2022 tritt Rojinski in der Comedy-Serie LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video auf und moderiert den Gipfel der Quizgiganten bei RTL.
Palina Rojinski: Herkunft und Biografie
Palina Rojinski wird am 21. April 1985 als Polina Roschinskaja in St. Petersburg geboren. Nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion wandern ihre Eltern nach Berlin aus. Palina Rojinski ist damals, im März 1991, noch keine sechs Jahre alt. Getauft nach russisch-orthodoxem Ritus, wächst sie in einer jüdisch-christlichen Familie auf.
Und so ist die kleine Palina Rojinski im wiedervereinigten Berlin der 90er-Jahre herumgelaufen – hier zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Dobermann.
Rhythmische Sportgymnastik: Palina Rojinskis sportlicher Karrierestart
Mit vier Jahren, noch zu Sowjetzeiten, beginnt Palina Rojinski mit rhythmischer Sportgymnastik.
Ihr Talent und sechs Stunden Training täglich wird sie später zur zweifachen Deutschen Meisterin bei den Juniorinnen machen. Doch irgendwann stecken ihre Knie die hohen Belastungen nicht mehr weg und sie muss die Sportart nach zehn Jahren aufgeben. Es folgen drei Jahre Tanzunterricht – schon allein um das bisherige Trainingspensum gleichmäßig abzubauen.
MTV engagiert Rojinski als Co-Moderatorin
Palina Rojinski macht in Berlin das Abitur und beginnt ein Literatur- und Geschichtsstudium an der renommierten Humboldt-Universität zu Berlin. Es werden jedoch nur drei Semester, denn das Fernsehen ruft. Namentlich MTV. Palina Rojinski wird als Co-Moderatorin der neuen Sendung MTV Home engagiert und damit zum Sidekick der Hauptmoderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.
Als Joko & Klaas zum ZDF wechseln und dort das Nachfolgeformat neoParadise (2011-2013) mit ähnlichem Konzept aufziehen, folgt Rojinski ihnen ebenso wie später zu ProSieben für Circus HalliGalli (2013-2017).
Zwar sind die von Joko und Klaas gestellten Aufgaben für Palina Rojinski nicht immer ein Spaß und erinnern mitunter an die demütigende Zeit von Elton als Show-Praktikant bei Stefan Raab in TV total.
Dennoch oder gerade deshalb sind diese TV-Formate für sie ein wahrer Karriere-Booster.
FINAL DESTINATION
MEMORANDUM
Wer eine rechtliche Abklärung in Auftrag gibt, erwartet in der Regel eine schriftliche Auskunft mit einer präzisen Analyse der Rechtslage, mit praxisgerechten Antworten auf konkrete Fragen und mit klaren Handlungsempfehlungen. Dafür hat sich in der Berufspraxis die Bezeichnung «Legal Memorandum» eingebürgert.
Schloss Neustrelitz
Das Schloss Neustrelitz – von 1731 bis 1918 Hauptresidenz der regierenden Herzöge und Großherzöge von Mecklenburg-Strelitz – war das erste Gebäude der 1733 gegründeten Stadt Neustrelitz.
Es wurde in den Jahren 1726 - 1731 im Auftrag von Herzogin Dorothea Sophie nach Plänen von Julius Löwe im Stil des Barocks erbaut.
Im Ergebnis der Novemberrevolution von 1918 wurde die Monarchie in Deutschland als Staatsform beseitigt; das Neustrelitzer Schloss wurde verstaatlicht und somit Eigentum des neu geschaffenen Freistaates Mecklenburg-Strelitz.
Zwischen 1918 und 1934 war das Schloss Sitz des Landtags vom Freistaat Mecklenburg-Strelitz; dort wurde die erste demokratische Verfassung eines deutschen Landes ausgehandelt.
Weitere Räumlichkeiten des vormaligen Residenzschlosses wurden seit März 1921 vom Mecklenburg-Strelitzschen Landesmuseum und der Mecklenburg-Strelitzschen Landesbücherei sowie seit 1925 auch vom Mecklenburg-Strelitzschen Hauptarchiv genutzt.
Nach Machtergreifung der Nationalsozialisten (1933) befand sich ab 1934 zunächst eine „SA-Stammschule für Geländesport“ im Schloss.
Diese wurde 1935 in eine „Führerschule des Hochschulinstituts für Leibesübungen“ der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin umgewandelt.
An dieser Bildungseinrichtung des NS-Staates wurden bis 1945 Sportlehrer/-innen ausgebildet aber auch Schulleiter und Beamte der Schulaufsichtsbehörden geschult.
Während des Zweiten Weltkrieges (1939–1945) befand sich neben der „Führerschule Neustrelitz“ und dem Mecklenburg-Strelitzschen Landesmuseum noch ein Lazarett im Neustrelitzer Schloss. Kurz vor Kriegsende – am 30. April 1945 – fiel das ehem.
Residenzschloss einem durch Brandstiftung verursachten Großbrand zum Opfer.
Nach Gründung der DDR wurde die Schlossruine 1949 gesprengt und in den 1950er Jahren bis auf die Grundmauern abgerissen.
Ab 2021/22 soll die Sicherung der erhaltenen Keller erfolgen und der 51 Meter hohe Schlossturm als wichtige Landmarke der Stadt wieder errichtet werden.



Eure freie Wahlentscheidung
Bilder von einer Zukunft in Wohlstand, Frieden, Würde, Freiheit und Wachstum für uns alle.
Die Deutschen und Israeliten sind das Volk Gottes.
Wir regieren die Welt gemeinsam, die Juden regieren das Geldsystem und die Deutschen bauen eine neue produktive und kreative Weltordnung auf, die auf Weisheit und Gerechtigkeit in fast völliger Freiheit im Glauben der Kirchenfürsten basiert.
Dank an die Heilige Familie Jesu und Marias nach Amerika!
Deutschland Ost & West - Gott mit uns!
Mit Brief & Siegel als Rohrpost und Einladung.
Ein Volk eine Zukunft christlich - Genesis, denn Palina & Gordon sind jüdisch & christlich und Emma Charlotte war atheistisch!
Lena Meyer-Landrut & Marek lebten und er starb für mich!
Neue Frankfurter Verfassung von 2025 - Europäisch - Eirene Reich
Dänische Verfassung schön und gut.
EUROPA VERFASSUNG & LANDESVERFASSUNGEN
Gordon Rusch & Reich Gottes - Eirene Reich & Lena Meyer-Landrut


















REISESTATIONEN










 |  |  |  |
|---|---|---|---|
 |  |

Was sagt Gott über die Menschen, welche Astrologen befragen und sich in ihrem Leben von Astrologie beeinflussen lassen? Die Bibel sagt in Jesaja 47, 13-15 (Simon): „Du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Pläne. Sie mögen doch herzu treten und dich retten, die Himmelseinteiler, die Sternenbeschauer, die nach den Neumonden ankündigen, was über dich kommen wird. Seht, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer verbrannte sie. Sie werden nicht ihr Leben aus der Gewalt der Flamme erretten können … Sie irren umher, ein jeder nach seiner Seite; keiner ist dein Retter.“
Astrologie ist eine Kunst der Wahrsagerei, welche lehrt, daß die verschiedenen Stellungen der Sonne, des Mondes und der Planeten am Himmel auf einzelne Menschen einen Einfluß ausüben sowie den Lauf menschlicher Ereignisse bestimmen. Das eigentliche Wort für Astrologie in der Hebräischen Sprache meint buchstäblich ‚himmlische Vorhersagung‘. Wahrsagerei ist die Tätigkeit Zukunftsereignisse vorher zusagen, geheime Kenntnisse zu offenbaren durch Zeichen und Omen oder anderen übernatürlichen Kräfte. Gott verbietet die Praktik der Wahrsagerei. Die Bibel sagt in 3. Mose 19, 26 (Simon): „Ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei treiben.“
Als die Israeliten im Begriff waren das Verheißene Land Kanaan einzunehmen, warnte Gott sie davor Wahrsagerei zu praktizieren. Die Bibel sagt in 5. Mose 18, 9, 12 & 14 (Simon): „Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir geben will, so sollst du nicht lernen, nach den Greueln dieser Völker zu handeln. … Denn diese Völker, die du aus ihrem Besitz verdrängen wirst, gehorchen Zeichendeutern und Wahrsagern; aber der Herr, dein Gott, erlaubt dir solches nicht.“
Wahrsagerei ist in der Tat als eine ernsthafte Sünde. Die Bibel sagt in 1. Samuel 15, 23: „Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst."
Als König Nebukadnezar einen Traum hatte, ließ er die Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammen rufen um ihm zu sagen was er geträumt hatte. Wie reagierten diese auf seine Forderung? Die Bibel sagt in Daniel 2, 10: „Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: ‚Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde‘.“
Die Astrologen von Babylon waren nicht in der Lage den König seinen beschwerlichen Traum zu deuten. Jedoch Gott hatte seinen frommen Propheten Daniel mit den wahren Gaben des Heiligen Geistes ausgestattet, und er wurde vor dem König gebracht um den Traum zu erzählen und zu deuten. Die Bibel sagt in Daniel 2, 27-28: „Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so.“ Mit der Salbung Gottes war Daniel in der Lage des Königs prophetischen Traum zu beschreiben und zu deuten.

Göttin mit den Rosenfingern
Aurora – „Morgenmutter der Sonne“ römische Göttin der Morgenröte, des Sonnenaufgangs
Aurora erscheint in der Frühe aus der dunklen Luft. Sie hebt mit Rosenfingern den Schleier der Nacht auf und leuchtet den Sterblichen eine Weile. Dann verschwindet sie vor dem Glanz des Tages.
Aurora ist die kraftvolle und doch so zarte Göttin des Neubeginns, des ersten Lichtscheins nach langer Dunkelheit. Wer an sie glaubt hat Hoffnung und Zuversicht, denn sie kommt immer wieder mit dem schwachen Schein des ersten Lichtes und diesem unvergleichlichen Duft und Tons des frühen Morgens.
Ihr Sohn Tithonius war auch ihr Geliebter, sie machte ihn als Gott des Tages zwar unsterblich, vergaß aber, ihm die ewige Jugend zu geben. So wurde er im Laufe des Tages grau, alt und runzelig und wurde abends schließlich zu einer Zikade, dem Symbol der wiederkehrenden Sonne.
Aurora vermählt sich auch mit Asträus aus dem Titanengeschlechte, einem Sohne des Krius und gebiert die starken Winde und den Morgenstern. Es lohnt sich, hin und wieder Aurora in diesen frühen Morgenstunden zu rufen und zu genießen, besonders, wenn im Leben gerade etwas zu neuem Leben erwachen soll, dunkle Schleier gehoben werden sollen.


Selene - Artemis - Diana
Selene (als Personifikation des Monats und poetisch manchmal auch Μήνη Mḗnē; bei den Römern Luna), die Göttin des Mondes, nach Hesiod Tochter des Hyperion und der Theia, Schwester des Helios und der Eos, auch Phoibe genannt, wird später mit der Mondgöttin Artemis (bei den Römern Diana) oder auch mit Persephone identifiziert.
Als ihre Eltern werden auch Helios oder Passas und die Euryphaessa, die weithin Leuchtende, ein anderer Name für Theia, genannt.
Selene gebar mit Zeus die Pandia und Ersa (Tau); mit Endymion, dem König von Elis, dem sie ewigen Schlaf schenkte, hat sie 50 Töchter.
Eine Erzählung berichtet, dass dieser immer noch schläft, weil Selene zarte Küsse mehr geschätzt haben soll als eine fruchtbare Leidenschaft. Eine andere Erzählung berichtet, dass der im Allgemeinen liebestolle Pan sie, in ein schönes weißes Vlies gehüllt, im Wald verführte.
Die Zahl 50 wird mit den 50 Monaten zwischen zwei Olympischen Spielen in Zusammenhang gesehen.
Auf Wunsch der Hera soll sie den nemeischen Löwen geschaffen haben, dem Herakles in seiner ersten Arbeit das Fell abziehen sollte.
Dargestellt wird Selene mit verschleiertem Hinterhaupt, die Mondsichel über der Stirn und eine Fackel in der Hand, auf Rossen oder Kühen reitend, auch vom Zweigespann gefahren, in Endymionreliefs zu ihrem Liebling herabschwebend, so auch in statuarischen Einzelwerken (Vatikan).
Umgeben von anderen Gottheiten, sieht man sie auf einem Altar des Louvre, wo sie vor sich den untergehenden Hesperos (Abendstern), hinter sich den Phosphoros (Morgenstern), unter sich die Maske des Okeanos hat, des Weltenstroms, aus dem sie hervortaucht.










Diana ist in der römischen Mythologie die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt, Beschützerin der Frauen und Mädchen. Ihr entspricht die Artemis in der griechischen Mythologie.
Als Varianten ihres Namens erscheinen auch Iana, Deana und Diviana. Abgeleitet wird der Name vom lateinischen dius („taghell“, „leuchtend“) und einer entsprechenden indogermanischen Wurzel *dei- mit der Bedeutung „glänzen“, „schimmern“, „scheinen“, von der sich auch Götterbezeichnungen wie griechisch Dios (Διός) für Zeus und lateinisch Deus („Gott“) herleiten lassen. Dementsprechend wird Diana nicht als eine ursprüngliche Mondgöttin angesehen, sondern als „die Leuchtende“, die dann als Gegenpart zur Sonnengottheit Apollo/Sol zur Mondgottheit neben Luna, der eigentlichen Mondgöttin, wird.
Als männliche Entsprechung der Diana wird aufgrund der Namenskonstruktion ein Gott Dianus angenommen. Ob dieser mit Janus identisch ist, ist aber umstritten, vor allem, da Dianus auch als Beiname des Jupiter erscheint.
Diana ist ursprünglich eine italische Gottheit. Ihr bedeutendstes Heiligtum (Dianium) befand sich in den Albaner Bergen bei Aricia am Nemisee, dem speculum Dianae, dem „Spiegel der Diana“.
Die Diana Nemorensis wurde dort zusammen mit Egeria und Virbius, zwei untergeordneten Gottheiten, verehrt. Das Heiligtum war gut besucht. Daher die zahlreichen Bettler, die Martial mehrfach erwähnt, die sich dort beim clivus Virbi versammelten. Es war auch so gut ausgestattet, dass Oktavian sich vom Tempel in Nemi ein Darlehen nahm.
Hauptheiligtum der Diana in Rom war ihr Tempel auf dem Aventin, der nach der Überlieferung von Servius Tullius gegründet worden war. Noch zur Zeit des Dionysios von Halikarnassos war die auf einer bronzenen Säule aufgezeichnete Stiftungsurkunde erhalten.
Das Heiligtum wird darin als „Dianatempel des Latinerbundes“ bezeichnet. Das Stiftungsfest an den Kalenden des Sextilis (1. August) stimmt mit dem des Heiligtums von Nemi überein.
An diesem Tag war ein Festtag der römischen Sklaven (servorum dies) und die römischen Frauen wuschen und pflegten ihr Haar besonders.
Dann zogen sie fackeltragend in einer Prozession zum Hain der Göttin von Nemi.
Ein Tempel der Diana-Artemis wurde von Marcus Aemilius Lepidus in einer Schlacht gegen die Ligurer 187 v. Chr. gelobt und acht Jahre später am Circus Flaminius geweiht.
Dieser Tempel wurde von Oktavian nach dem Sieg über Sextus Pompeius in der Seeschlacht von Naulochoi 36 v. Chr. restauriert.
Gleichzeitig restaurierte Lucius Cornificius den Dianatempel auf dem Aventin, der daher Tempel der Diana Cornificiana genannt wurde.
Augustus weihte 28 v. Chr. seinen (36 v. Chr. gelobten) Apollotempel auf dem Palatin auch der Diana Victrix (der „sieghaften Diana“), die Säkularfeiern des Jahres 17 v. Chr. wurden unter den Schirm der Geschwister Apoll und Diana gestellt und in der Kaiserzeit gab es Widmungen für Diana Augusta (die „erhabene/kaiserliche Diana“).
So war Diana schließlich völlig in den Rahmen kaiserlicher Propaganda integriert.
Auffällig ist, dass sämtliche stadtrömischen Weihungen aus der Zeit der Republik außerhalb des Pomeriums liegen, also außerhalb der römischen Stadtgrenzen im religiösen Sinn.
Auch die alten Heiligtümer Latiums liegen sämtlich außerhalb von Städten. Man hat das dahingehend interpretiert, dass Diana sich darin als eine Gottheit der Wildnis und des „Draußen“ erweist.
Als Göttin der Wildnis wurde sie zusammen mit Silvanus verehrt und als Gottheit der Grenze (zwischen Wildnis und Zivilisation) von den an den Grenzen des Imperiums stationierten Truppen.
Inneres des Tempels der Diana in Nimes (Hubert Robert, 1771)
In der Kaiserzeit finden sich Kultstätten der Diana im gesamten Reich, wobei „Diana“ hier häufig die Interpretatio Romana einer lokalen Gottheit ist. So steht Diana z. B. für die syrische Göttin von Hierapolis oder für Abnoba oder Arduinna bei den Kelten.
Ursprünglich scheint Diana hauptsächlich eine Helferin der Frauen bei der Niederkunft gewesen zu sein. Als eine Göttin des „Draußen“ bewahrte sie die Frauen vor dessen Gefahren, also vor allem vor dämonischen Anfechtungen während der Geburt. Ihre Rolle als Helferin bei der Geburt drückte sich auch in ihrem Beinamen Lucina aus, den sie mit Juno, der anderen Geburtshelferin teilte: sie war diejenige, die das Kind ans Licht brachte, es das „Licht der Welt“ erblicken ließ.
Votivgabe für Diana als Dank für Erfolg bei der Bärenjagd, Römisch-Germanisches Museum, Köln
Ihre Bedeutung als Göttin der Frauen und Geburtshelferin (obstetrix) wird belegt durch zahlreiche sich auf Geburt und Fruchtbarkeit beziehende Votivgaben, die man in Nemi gefunden hat, z. B. Vulven, Phalli, Mütter mit Säuglingen etc. Wissowa argumentiert daher, dass Diana Nemorensis an sich keine politische Göttin gewesen sei, sondern ihre politische Bedeutung nur daher rühre, dass Aricia der Hauptort eines latinischen Städtebundes gewesen sei.
Es finden sich auch Votivgaben für Jagderfolg, so etwa von einem in Germania inferior stationierten Centurio, der sich dafür bedankt, innerhalb von nur sechs Monaten 50 Bären gefangen zu haben.
Die Tiere wurden bei Tierhetzen in der Arena benutzt.
Von einem ursprünglichen Mythos der Diana – unabhängig von der griechischen Mythologie – ist nichts überliefert, da Diana schon sehr früh und fast vollständig mit der griechischen Artemis identifiziert wurde. Die griechischen Mythen wurden unter Ersetzung der griechischen Gottheiten mit ihren römischen Entsprechungen übernommen.
Demnach ist Diana Jupiters Verbindung mit Latona entsprungen, war die Schwester des Apollo, blieb Jungfrau, vermählte sich nicht usw.
Auch die Verbindung von Artemis und Hekate wurde auf Diana übertragen, weshalb Diana als Attribut neben dem Bogen sehr oft die Fackel der Hekate trägt.
Da Hekate auch die Göttin der Scheidewege und Wegkreuzungen (trivium) war, erscheint ab augusteischer Zeit Trivia als Name der Diana.
Vergil nennt den Nemisee auch lacus triviae.
Die keltische Göttin Artio wird in der Interpretatio Romana ebenfalls der Diana gleichgesetzt.
Die Behauptung, das Kultbild in Aricia sei dreigestaltig gewesen wie manche Darstellungen der Hekate, lässt sich alleine aus dem Namen nicht ableiten.
Vielmehr stellten das Kultbild von Nemi ebenso wie das Kultbild der Diana Tifatina (zumindest in den erhaltenen Kopien) sie als jugendliche Jägerin dar mit kurzem Chiton, Köcher und Bogen, Jagdstiefeln und Fackel, ähnlich dem bekannten Typus der „Diana von Versailles“.
Oft wird sie als junge Jägerin mit kurzem Chiton, Köcher mit Pfeilen und Bogen und einem jungen Hirsch dargestellt.
Denar mit dreigestaltiger Gottheit
Dass es sich bei dem Denar des Publius Accoleius Lariscolus aus dem Jahr 43 v. Chr., der auf dem Revers drei weibliche Gottheiten zeigt, um eine Darstellung der Diana Nemorensis handelt, ist nicht gesichert.
Die Göttinnen tragen Bogen, Zweig und Fackel oder Stab als Attribute und sind durch ein Joch oder einen Balken auf Schulterhöhe verbunden.
Das Kultbild des aventinischen Tempels soll vom Typus der Artemis von Ephesos gewesen sein, da es nach Strabon ein Abbild der Artemis von Massilia war, die wiederum der ephesischen Artemis entsprach.
Im Mittelalter wurde Diana zur Göttin der Hexen.
Das scheint durch zahlreiche Belege aus mehreren Jahrhunderten gesichert. Bereits 906 erscheint des Regino von Prüm De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, darin enthalten der Canon episcopi, eine Sammlung von Anweisungen für Bischöfe und ihre Vertreter.
In einer Liste auszumerzender Vorstellungen steht dort:
Es darf nicht übergangen werden, daß es gewisse verbrecherische Frauen gibt, die Satan gefolgt sind und, durch Blendwerk und Vorspiegelungen der Dämonen verführt, glauben und bekennen, des Nachts zusammen mit der heidnischen Göttin Diana und einer unzählbaren Menge von Frauen auf gewissen Tieren zu reiten, in der Stille der Nacht große Entfernungen zurückzulegen, die Weisungen der Göttin zu befolgen, als wäre sie die Herrin, und in bestimmten Nächten zu ihrem Dienst gerufen zu werden.
Hier ist der ganze Mythos vom Hexensabbat vorgebildet, mit dem Unterschied, dass nicht Satan, sondern die heidnische Diana Herrin des Sabbats ist. Ähnliches findet sich im Buch XIX des Decretum des Burchard von Worms, der zur Göttin Diana die biblische Herodias ergänzt.
Der italienische Historiker Carlo Ginzburg meldete allerdings in seiner Untersuchung des Hexenwesens Zweifel an der Authentizität der Diana in solchen Texten und den (späteren) Berichten der Hexenverfolger an.
Er vermutete eine Art Interpretatio Romana, also dass bei der Aufzeichnung von Aussagen der Hexerei Angeklagter die von diesen genannten Namen in andere, den Autoren der Texte geläufige übersetzt wurden.
Gelegentlich tauchen diese authentischen Namen doch auf, dann ist die Rede von einer Bensozia (vielleicht Bona Socia: „gute Gefährtin“) und Madona Horiente, so die Akten eines Verfahrens von 1390.
In den Aufzeichnungen des Inquisitors Beltramino da Cernuscullo liest man jedoch stattdessen das „Spiel der Diana, die sie Herodias nennen“.
In einem anderen Fall, der sich in einer Predigt des Nikolaus von Kues findet, berichtet dieser von Frauen, die bekannt hatten, zu einer „Gesellschaft der Diana“ zu gehören, die sie als Quelle des Reichtums verehren, als „sei sie Fortuna“ (quasi Fortunam).
Und er verweist auf die Diana von Ephesos, die schon seit jeher eine Widersacherin des Glaubens gewesen sei, wie sich ja auch der Apostelgeschichte entnehmen lasse.
Dann ergänzt er noch, dass diese Frauen die Göttin in italienischer Sprache Richella nennen würden, was „Mutter des Reichtums und der glücklichen Fügung“ bedeute, daher Fortuna.
Und gelehrt fährt er fort, diese sei offenbar als Abundia oder Dame Habonde zu identifizieren, eine mittelalterliche Sagengestalt, die auf die römische Abundantia zurückgeht.
Die von Ginzburg angeführten Beispiele lassen an einem Überleben der antiken Diana im Glauben des Volkes zumindest Zweifel aufkommen.
Was hier tatsächlich authentisch ist und was von – mit den heidnischen Göttern wenn nicht durch antike Autoren, dann zumindest durch die apologetischen Schriften der Kirchenväter vertrauten – Theologen konstruiert wurde, lässt sich heute fast nie mehr entscheiden.
So beispielsweise Diana als Anführerin der Wilden Jagd: In den Predigten des Dominikaners Johannes Herolt werden in einer Auflistung abergläubischer Personen solche erwähnt, die glauben, dass „Diana, in der Volkssprache Unholde oder die selige Frawn genannt, in der Nacht mit ihrem Heer umgeht und sie große Distanzen zurücklegen.“
Dass in einigen Sprachen und Dialekten eine Bezeichnung für „Hexe“ sich vom Namen „Diana“ ableiten lässt – jana im Alttoskanischen und im Sardischen, janára im Neapolitanischen, gene im Altfranzösischen, šana im Asturischen, jana im Altprovenzalischen usw. –, ist auch kein Beleg für das Überleben einer lebendigen Tradition der heidnischen Gottheit.


Römische Göttin Ceres
Ceres (ausgesprochen [ˈt͡seːʁɛs], im klassischen Latein [ˈkɛ.reːs]) ist die römische Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit und gilt als Gesetzgeberin. Sie ist die Tochter der Ops und des Saturn. Im Griechischen heißt Ceres Demeter. Sie hatte mit Jupiter zwei Kinder: Proserpina und einen ungenannten Jungen. Die Interpretatio Romana stellt allerdings der eleusinischen Trias Demeter, Iakchos und Kore diejenige von Ceres, Liber und Libera gebildete aventinische Trias gegenüber.
Die Attribute der Ceres waren Früchte, Fackel, Schlange, Ährenkranz oder Ährengarbe sowie Ameise. Heilig waren ihr weiterhin der Mohn und das Schwein. Ceres wird mit weizenblonden Haaren beschrieben, die oft lang getragen, aber auch zu Zöpfen geflochten sind. Manchmal trägt sie ein Füllhorn.
Die sie begleitende Schlange, die in Klüften und Felsen lebt und auf der Erde kriecht, wird symbolisch weithin als chthonisches Abzeichen gedeutet.
Die Fackel trug sie als Symbol aus dem eleusinischen Mysterienkult (siehe Mysterien von Eleusis).
Auch Demeter ist mit Fackel abgebildet. Sie scheint also eine spätere Errungenschaft zu sein. Die Fackel selbst bedeutet: Wegleuchten, also jemandem den Weg leuchten.
Der Sage nach soll Ceres auch nachts mit einer Fackel nach ihrer Tochter Proserpina suchen.
Das Schwein, ein in der Erde wühlendes Tier, ist der Demeter wie der Ceres heilig. Hier besteht keine Übertragung, sondern eine Identität von der Sache her, als die Aufbrüche und Suhlen der Schweine auf dem Lande wahrscheinlich auf der Kulturstufe des Übergangs zum Ackerbau die ersten „Äcker“ gewesen sind, also die Stelle, an denen das Aufgehen von Samen beobachtbar war.
Der Mohn war ebenfalls eine Gabe der Demeter. Schon bei der babylonischen Ištar war Mohn ein Symbol. Man vermutet, dies sei der vielen Samen der Mohnkapsel wegen geschehen, welche Fruchtbarkeit symbolisieren sollen. Ob die schon frühzeitig bekannte berauschende Wirkung des Mohnsaftes eine Rolle spielte, steht nur zu vermuten.
Der Ährenkranz oder die Ährengarbe stehen als Symbol für die Nahrung. Dabei handelt es sich wesentlich um Weizen und um Gerste, den beiden vorherrschenden Getreidearten.
Das Füllhorn ist ein Symbol des materiellen Glückes. Es ist in erster Linie Attribut des Plutos, des Gottes der Unterwelt und des Reichtums.
In allegorischen Darstellungen der vier Jahreszeiten verkörpert Ceres den Sommer.
Der Name Ceres stellt sich zu lateinischen Verben, wie crescere – wachsen und creare – erschaffen, hervorbringen, zeugen/gebären, wählen; wohl aber auch zu cernere – entscheiden. Sicher gehört auch cera – das Wachs und cervus – der Hirsch hierher. Ausgesprochen wurde der Name Ceres im klassischen Latein mit unaspiriertem K, Zungen-R, offenem E (ä), wobei das zweite E lang war, und scharfem Eszett: Kerreeß [kerε:s].
Vermutlich ist ihr Ursprung etruskisch. Sie gilt als altitalische römische Gottheit, deren Wesen durch Angleichung an Tellus und oskisch oder etruskisch vermittelte Vermischung mit Demeter verdunkelt wurde. Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. ist sie das römische Pendant zur griechischen Göttin Demeter.
Die Interpretatio romana der griechischen Trias Demeter, Dionysos und Kore (Κόρη – Mädchen) ist eine Interpretation und keine Identifikation. Bemerkenswert bleibt allerdings in diesem Zusammenhang die Nähe des Begriffes Tellus (Erdreich, Erde) zu dem der Demeter, gr. Δημήτηρ = gr Γῆ-μήτηρ = Erdmutter und auch die etymologische Verwandtschaft von Ceres und Kore. Auch mythologisch wäre es sinnvoll, das Wachstum (Ceres = Kore = Mädchen) als Frucht der Erdmutter darzustellen.
Die Ceres gilt mit Tellus und ihren altitalischen Kindern Libera und Liber als chthonische Dea. Sie wird den Inferi zugeordnet, also den in der Erdinnenwelt lebenden Wesen, woran auch ihre „Zuständigkeit“ für den Tod erinnert. Diese ursprüngliche nicht-gräzisierte Trias war eventuell das plebejische Gegenstück zur kapitolinischen Trias (Jupiter, Mars, Quirinus) der Patrizier. Indem diese vom Himmel kommend als Abkommen der Superi galten, mussten folgerichtig die vulgären Plebejer inferioren Ursprungs, also irdischer Herkunft sein.
Da es keine Dogmatik gab in der römischen Religion, gab es auch keine absolute Trennung zwischen Tellus und Ceres, und es ist zu vermuten, dass der von Ovid gemachte Unterschied durchaus nicht Allgemeingut der Kultgemeinde war.
Die früheste nachweisbare staatliche Verehrungsstätte in Rom war eine halbkugelförmige Vertiefung in die Erde, der auf dem Forum Romanum neben dem Comitium (Versammlungsort des Volkes) am Fuße des Capitols gelegene sogenannte Mundus Cereris.
Ein dreizelliger Tempel mit noch etruskischem Grundriss, zwischen Circus Maximus und Aventin gelegen, wurde ihr und den Göttern Liber und Libera ab 496 v. Chr. erbaut, weil der Diktator Postumius wegen einer Hungersnot auf Weisung der sibyllinischen Bücher der Ceres einen Tempel gelobt hatte, und 493 v. Chr. durch den Konsul Spurius Cassius geweiht. Geopfert wurde hier ausschließlich der Ceres. 31 v. Chr. brannte diese sogenannte aedes Cereris ab, wurde von Augustus erneuert und von Tiberius im Jahr 17 n. Chr. geweiht.
Relativ früh erhielt der Tempel einen eigenen Priester, den flamen Cerialis, der aus dem Volke kommen durfte.
Man vermutet, dass aus dem Vorsteher dieses für die römischen Plebejer so wichtigen Gebäudes, des templum Cereris, das Aedilat entstanden ist, denn den Ädilen oblag die cura annonae, also die Aufsicht über Getreidespenden und Marktgerechtigkeit, was unter anderem die Preisüberwachung einschloss. Dieser Tempel war der sakrale Mittelpunkt der römischen Plebs, hatte Asylrecht und beherbergte die Kasse der römischen Plebs. Hier befand sich auch das Staatsarchiv für Volks- und Senatsbeschlüsse.
Vom Tempel der Ceres in Rom gingen die secessiones von 494 v. Chr. und 450/449 v. Chr. aus, der Auszug der Plebejer auf den Mons Sacer, mit welchem sie die Patrizier bezwangen und die Einführung des Plebiszits durchsetzten.
Die Volkstribunen waren der Ceres gegenüber zur Einhaltung der Gesetze verpflichtet.
Auffällig ist die Zwölfzahl, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in diesen Sondergöttern alte bäurische Monatsgenien weiterleben. Ihre Namen decken sich zum Teil mit Sondergöttinnen des Ackerbaus aus früh- und vorrömischer Zeit. Diese waren Seia (Säerin), Segetia oder Segesta (Seges, etis, f – Saat), Messia (Mäherin) und Tutulina (die Schützende). Diese Genien, nach Plinius im Circus ausgestellt, waren einer mittelmeerländischen Korngöttin zugeordnet, welche die italischen Einwanderer später Ceres nannten.
Sie lassen vermuten, dass die Feldarbeit ursprünglich vorwiegend in den Händen der Frauen lag.
Nach beendeter Frühjahrssaat wurden Ceres und Tellus an den beweglichen feriae Sementivae an zwei durch sieben Tage getrennten Tagen im späten Ianuarius oder frühen Februarius eine trächtige Sau und Spelt dargebracht.
Durch den älteren Cato wissen wir, dass die Ceres zu den Numina der Bauernhöfe zählte. Der private Kult dürfte noch älter sein als der öffentliche. Beim Tode eines Familienangehörigen wurde der Ceres sofort eine Sau, die porca praesentanea, dargebracht.
Mit Sicherheit handelte es sich dabei nicht um ein Ganzopfer, ein Holokaustum, bei dem das Opfer ganz verbrannt wurde, sondern um ein Mahlopfer, bei dem nur Teile der Göttin dargebracht und der große Rest zubereitet und als Leichenschmaus von den Menschen verzehrt wurde.
Da Ceres eine der Inferi war, werden ihr die Gaben nicht über das Feuer übergeben, sondern einfach in eine Grube gelegt worden sein. Ähnliches wird von den Thesmophorien in Bezug auf Demeter berichtet.
Ob eine ursprüngliche Identität zwischen Demeter und Ceres besteht – waren doch beide Völker nahe verwandte Indogermanen – sei dahingestellt. Immerhin hielten die Römer Enna in Sizilien, das zu Magna Graecia gehörte, für die Heimat der Ceres.
Auch waren schon lange Priesterinnen aus Unteritalien in ihrem Dienst. Gegen 250 v. Chr. jedenfalls wurde der Cereskult vor allem durch griechische Priesterinnen vollzogen. Hier fassen wir eine Spezialisierung auf den Getreideanbau.
Der Kult wandelte sich zu dem durch die Demeter in den Tesmophorien vorgegebenen Schema hin, wo diese auf der Suche nach ihrer Tochter Persephone (Kore in der römischen Mythologie Proserpina) war.
Auch die schon frühe Angleichung des altrömischen Libers an den Dionysos mag mehr als späte theoretisierende Systematik sein.
Die Cerialia stehen im Festkalender zum 19. April. Sie lagen mit genau drei Tagen Zwischenraum zwischen den Fordicidien (Kuhfest) und den Vinalia (Weinfest). Spätestens seit dem dritten Jahrhundert v. Chr. wurden Ludes (Spiele) von den plebejischen Ädilen gegeben.
Zwischen 249 und 218 v. Chr. wurde der Ceres ein Jahresfest im Hochsommer nach griechischem Ritus eingerichtet. Während dieses Festes war Enthaltsamkeit von Wein und Brot, und eventuell auch vom Gebrauch der pudenda – der Geschlechtsteile – Gebot.
Es hieß Initia cereris – „Eingang in Ceris“ – wobei darunter eventuell eine Einweihung oder auch eine Invokation zu verstehen ist. Eine andere Theorie besagt, dass damit Anfang des Wachstums gemeint war und der Festname vom Frühlingsfest auf das Sommerfest gelegt wurde.
Der Vollständigkeit halber sei hier genannt, dass dem altitalischen Paare Liber / Libera am 17. März die Liberalia gefeiert wurden. Diesen Tags boten alte Frauen selbstgebackene Opferkuchen Libum = Kuchen feil, welche sie für den Kunden dann auf kleinen Herden opferten. Ebenso nahmen die Knaben Gelegenheit, die Männertoga anzulegen.
Ovid beschreibt Ceres als Gesetzgeberin. Als solche wird sie auch schon in den Zwölftafelgesetzen genannt. Möglicherweise spielt hier Demeter als Herrin der Thesmophorien eine Rolle, wegen der Doppelbedeutung des Thesmon als „Niedergelegtes / Niedergeschriebenes“.
Auf den Ackerbau als Beginn der Gesetzlichkeit weist der griechische Stamm νέμ-, auch in unserem dt. „nehmen“ und „Name“ enthalten, von dem sich im klassischen Griechisch zwei, dort nur durch den Akzent unterschiedene, gleich unserem „Weg“ und „weg“nehmen, Substantiva ableiten, nämlich νόμος = Gesetz und νομός = Weideland. Letzteres spiegelt sich in Nomaden wider, ersteres etwa in Oekonomie.
Auch im Deutschen wird deutlich, dass Gesetz etwas mit Besitz und dieser etwas mit Sesshaftigkeit, und diese etwas mit Ackerbau zu tun hat. Wir haben also hier ein sprachliches Fossil vor uns. Anhand dessen können wir uns vorstellen, wie Ceres zur Gesetzgeberin geworden sein könnte.

Vatikan
Die Vatikanstadt liegt in Rom westlich des Tiber auf dem Vatikanischen Hügel, der damit die höchste Erhebung des Landes darstellt. Sie ist an einigen Stellen von einer Stadtmauer umgeben, deren Verlauf deckt sich jedoch nicht vollständig mit der Grenze des Staatsgebiets.
Sie wird von den römischen Stadtteilen Municipio I und Aurelio umgeben und grenzt an die historischen Rioni Borgo und Prati. Auf dem Staatsgebiet befinden sich neben dem Petersdom, Petersplatz und dem Apostolischen Palast auch die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle. Den größten Teil des Staatsgebietes machen die Vatikanischen Gärten aus.
Es gibt eine Vielzahl exterritorialer Besitzungen des Heiligen Stuhls, denen ein Status ähnlich von Botschaftsgeländen zukommt und die nicht Teil des Staatsgebietes der Vatikanstadt sind.
Dazu gehören unter anderem direkt an das Staatsgebiet angrenzende Gebiete wie der Palazzo San Pio X, der Campo Santo Teutonico und der größte Teil der Vatikanischen Audienzhalle.
Die Staatsgrenze verläuft mitten durch die Audienzhalle, wobei der Papstthron noch auf vatikanischem Staatsgebiet steht, die anwesenden Besucher der Audienz sehen jedoch aus dem italienischen Ausland zu.
Auch die römischen Patriarchalbasiliken, der nordwestliche Teil des Gianicolo, verschiedene Paläste in der römischen Altstadt, die päpstliche Sommerresidenz Castel Gandolfo und ein Sendezentrum von Radio Vatikan in Santa Maria di Galeria sind exterritoriale Besitzungen des Heiligen Stuhls.

Sólo Dios basta – Gott nur genügt!
Teresa von Ávila
Dieser Satz ist durch Teresa von Ávila berühmt geworden; es hieß, dass man nach ihrem Tod ein kleines dreimal dreizeiliges Gedicht in ihrem Brevier gefunden hätte, das mit den Worten endet:
„Sólo Dios basta – Gott nur genügt“.
An Teresas Autorschaft gab es bis in die jüngste Vergangenheit hinein kaum Zweifel.
Nichts dich beirrre,
nichts dich verwirre;
alles vergeht,
Gott zieht nicht um.
Geduld
erreicht alles;
wer Gott in sich hat,
dem fehlt nichts:
Nur Gott genügt.
Der geistliche Grundgedanke spricht ohne Weiteres für Teresa als Verfasserin, in deren Schriften das Wortpaar „Nada – Nichts“ und „Todo – Alles“ vorkommt.
Für Teresa als Verfasserin sprechen auch scheinbar die ganze Tradition und die Tatsache, dass die spanischen Editoren ihrer Schriften dieses Gedicht in ihre Ausgaben aufgenommen haben.
Mit dem Text leben
Heute wissen wir dank der Studien von Mariano Delgado, dass dieses Gedicht, so weit man bis jetzt weiß, zum ersten Mal in der Guía espiritual – Geistliches Weggeleit von Miguel de Molinos aus dem Jahre 1675 schriftlich fixiert vorliegt, wobei man bis jetzt nicht weiß, wie es in den angeblichen geistlichen Besitz Teresas gekommen ist.
Die erste deutsche Übersetzung steht nicht in der Ausgabe der Schriften Teresas in der Übersetzung von Ludwig Clarus aus dem Jahre 1851 und noch weniger in der Vorgängerausgaben, sondern in der ersten deutschen Übersetzung des Werkes Molinos´, die 1699 unter Leitung des Pietisten Gottfried Arnold herauskam; sie lautet: „Lass dich nichts verunruhigen noch erschrecken; sintemahl alles vergeht und ein Ende hat, Gott aber allein unwandelbar ist, und die Geduld alles überwindet.
Wer Gott hat, der hat alles; und wer ihn nicht hat, dem mangelt alles.“ Weder Molinos noch der erste deutsche Übersetzer bringen den berühmten, aber schwer zu interpretierenden letzten Vers „sólo Dios basta.“
Wenn man diesen Text mit Teresa von Ávila in Zusammenhang bringt, dann muss man ihn von ihrem Grundgedanken her verstehen und übersetzen, und dieser ist, dass der Mensch – die Seele – Wohnort Gottes ist, wie sie in ihrem Hauptwerk, die Innere Burg, meisterhaft darlegt. Sie schreibt: „In der innersten Mitte von all diesen Wohnungen liegt die vornehmste, in der die höchst geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen“.
Ihrer Meinung nach ist die Seele von Gott bewohnt, der Mensch ist Wohnort Gottes, „Tempel des Hl. Geistes“, wie Paulus sagt
(1 Kor 6,19). In ihrem Handbuch zum inneren Beten, dem Weg der Vollkommenheit, sagt sie es so:
„Es gibt in uns noch etwas unvergleichlich Kostbareres als das, was wir von außen sehen. Stellen wir uns doch nicht vor, wir seien innen hohl“
(Weg [Escorial] 48,2; [Valladolid] 28.10).
In diesem Sinn wird der Text zu einem Trostgedicht: Gott zieht nicht aus dem Menschen aus (mudarse heißt auch ; eine mudanza ist ein Umzug); daraus folgt: Wer Gott bei sich, in sich hat, dem fehlt nichts.
Genügt nur Gott?
Unglücklicherweise wurde die letzte, die am bekanntesten gewordene Zeile im Deutschen mit „Gott allein genügt“ übersetzt. Häufig verstand man dieses Kernwort der karmelitanischen Spiritualität dann so, als brauche der Mensch nur Gott, nichts weiter, oder gar als habe er sich allein um Gott zu sorgen und den Blick von allem Menschlichem und Geschöpflichem abzuwenden.
Das „sólo“ ist adverbial, nicht adjektivisch zu lesen. Es meint: erst Gott reicht aus, um wirklich Erfüllung zu schenken; hätte ich alles, was das Leben bieten kann, aber die Gemeinschaft mit Gott nicht – es wäre alles flach, leer, ungenügend, wie ein „Nichts“. Gerade die hier gemeinte Erkenntnis, dass erst Gott – also „nur Gott“ – dem Menschen entspricht und genügt, gibt allem Sinn und Wert, Tiefe und Größe:
Die Liebe dieses Gottes, dessen Blicken Lieben ist, wie Johannes vom Kreuz schreibt, und das daraus folgende Leben mit ihm verleihen den Dingen Schönheit, dem Nächsten Größe, der Freundschaft und Partnerschaft Tiefe und ewige Endlosigkeit.
Ulrich Dobhan OCD
Inneres Beten
Inneres Beten ist Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.
Teresa von Ávila
Wer das Exerzitienhaus am Karmel Birkenwerder bei Berlin besucht, erblickt schon von der Straße her im Klostergelände ein aus Holzbalken gefertigtes Bildnis zweier Gestalten.
Die kleinere in Braun und Beige, den Farben des Ordenshabits der Karmelitinnen und Karmeliten, stellt Teresa von Ávila dar; die größere in Grün, der Farbe des Lebens, symbolisiert Christus, den Lebendigen und auch heute Gegenwärtigen.
Das Bildnis drückt einen wesentlichen Grundzug in der Spiritualität Teresas aus, den man zusammenfassend so formulieren kann:
In Freundschaft mit Christus den Menschen, den Aufgaben, der Welt zugewandt sein.
In einer Zeit, in der den Gebetsverrichtungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als dem „Adressaten“ des Betens und die Gläubigen vor dem gestrengen Weltenrichter in Angst und Furcht um das eigene Heil bangten, entdeckt Teresa im menschgewordenen Jesus Christus Gott als den Freund ihres Lebens. Sie erkennt nun:
„Er, der große Gott, war doch auch Mensch, der sich nicht über die Schwächen der Menschen entsetzt, sondern unsere armselige Lage versteht. Ich kann mit ihm reden wie mit einem Freund, obwohl er doch der Herr ist.“
Wer die Schriften Teresas liest, wird darin immer wieder dem Stichwort Inneres Beten begegnen.
Es ist ein Schlüsselwort zum Verständnis ihrer von der Christusfreundschaft getragenen Spiritualität – und ein Kernwort in der Spiritualität des Teresianischen Karmel. Teresa hat dieses Wort nicht selbst geprägt.
Sie übernahm es aus der schon in ihrem Jahrhundert langen geistlichen Tradition des Christentums.
Der kleine Schritt in einen lebendigen Glauben
Inneres Beten ist der kleine Schritt in einen lebendigen Glauben. Inneres Beten heißt: sich zu Gott hinwenden von Ich zu Du, „an Gott denken“, sich seine Gegenwart bewusst machen, zu Gott „du“ sagen und dieses „du, Gott …“ auch wirklich meinen.
„Meiner Meinung nach“, schreibt Teresa ihren Schwestern, „ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.
Inneres Beten hat keine Methode, die man erlernen müsste. Inneres Beten ist selbst die „Methode“, die einzige und allein notwendige, die man „können“ muss, um im eigentlichen Sinne ein glaubender Mensch zu sein – ein „von innen her“ glaubender Mensch, worauf Jesus so viel Wert legte. Es ist etwas ganz einfaches. Jeder kann es (schon).
Ich rede Gott an, von innen heraus, so dass wirklich ich es bin, der da redet; ich sage „du“ zu Gott, zu diesem unfassbar großen Gott, den ich freilich nur „ahnen“ kann. Wie von selbst sagt dann nicht nur der Verstand das „du“; inwendige Tiefenbereiche „sprechen“ mit.
Aus dem „du“-Sagen wird eine stille, worthafte oder auch wortlose Zuwendung, ein Sich-Zublicken, ein „Entgegen-Warten“ zu dem großen Geheimnis hin, das mich und alle Existenz umfängt, zu diesem Gott von unfassbarer Größe und Weite, so verborgen und so nahe zugleich.
Der Weg in eine neue Art das Leben zu leben
Übt man sich – nicht nur während besonderer Gebetszeiten, sondern so oft man daran „denkt“ – in diese „Vergegenwärtigung Gottes“ ein wenig ein, verändert sich das ganze Lebensgefühl.
Bisher brachliegende Kräfte der Seele werden wach, man bekommt für alles einen tieferen Blick.
Glaube wird eine Lebensweise, ein Mitleben, Mitlieben, Mitleiden mit Jesus und seinem Gott.
Inneres Beten ist in der Tat ein ganz einfaches, für jeden Menschen vollziehbares „Tun“ der Seele, das während der Gebetszeit das „Gebete-Verrichten“ zum Beten macht und während des Tages das Leben und Arbeiten ein Gemeinschaftswerk mit Gott werden lässt.
Es ist der Weg in eine neue Art das Leben zu leben.
Die Regel des Karmel, gegeben durch Albert von Jerusalem um 1210
Das geistliche Grunddokument aller Orden und Gemeinschaften der Karmel-Familie in der offiziellen Nummerierung
1. Albertus, durch Gottes Gnade Patriarch der Kirche von Jerusalem, an die in Christus geliebten Söhne B. und die übrigen Eremiten, die unter seinem Gehorsam beim Brunnen auf dem Berg Karmel leben: Gruß im Herrn und des Heiligen Geistes Segen!
2. Oftmals und auf vielfache Weise haben die heiligen Väter gelehrt, wie einer, welchem Lebensstand er auch angehört oder welche Form von Ordensleben er gewählt hat, in der Gefolgschaft Jesu Christi leben und ihm mit reinem Herzen und gutem Gewissen treu dienen soll.
3. Da ihr uns ersucht habt, euch eurem Vorhaben gemäß eine Lebensregel zu geben, die ihr in Zukunft halten sollt:
4. bestimmen wir als erstes, dass ihr einen von euch als Prior haben sollt, der durch die einmütige Zustimmung aller oder des größeren und verständigeren Teils zu diesem Amt gewählt wird. Jeder von euch soll ihm Gehorsam versprechen und bemüht sein, das Versprochene zugleich mit der Keuschheit und dem Verzicht auf Eigentum auch tatsächlich zu halten.
5. Niederlassungen könnt ihr an einsamen Orten haben oder wo sie euch geschenkt werden, sofern sie für die Beobachtung eures Ordenslebens passend und geeignet sind, so wie es dem Prior und den Brüdern förderlich zu sein scheint.
6. Je nach Lage des von euch gewählten Ortes soll jeder einzelne von euch eine eigene, abgesonderte Zelle haben, wie sie nach Anordnung des Priors und mit Zustimmung der übrigen Brüder oder des verständigeren Teils einem jeden zugewiesen wird;
7. jedoch so, dass ihr im gemeinsamen Refektorium das, was euch gegeben wird, miteinander genießt, wobei ihr eine Lesung aus der Hl. Schrift hört, wo dies leicht beobachtet werden kann.
8. Außerdem ist es keinem Bruder ohne Erlaubnis des jeweiligen Priors gestattet, die ihm angewiesene Zelle zu wechseln oder mit einem anderen zu tauschen.
9. Die Zelle des Priors soll sich am Eingang der Niederlassung befinden, damit er als erster allen, die dorthin kommen, begegnen kann und dann alles, was zu tun ist, nach seinem Ermessen und auf seine Anordnung hin geschehe.
10. Jeder einzelne soll in seiner Zelle oder in ihrer Nähe bleiben, Tag und Nacht das Wort des Herrn meditierend und im Gebet wachend, es sei denn, er ist mit anderen, wohlbegründeten Tätigkeiten beschäftigt.
11. Wer die kirchlichen Tagzeiten mit den Klerikern zu beten versteht, soll sie entsprechend der Anordnung der heiligen Väter und der von der Kirche gutgeheißenen Gewohnheit beten. Wer dies jedoch nicht kann, bete zur Matutin fünfundzwanzig Vaterunser. Eine Ausnahme bilden die Sonn- und Feiertage, für die wir die Verdoppelung dieser Zahl anordnen, so dass also fünfzig Vaterunser zu beten sind. Siebenmal soll dieses Gebet zu den Laudes gebetet werden. Zu jeder anderen Tagzeit soll es ebenfalls siebenmal gebetet werden, ausgenommen zur Vesper, bei der ihr es fünfzehnmal beten sollt.
12. Keiner der Brüder soll etwas sein eigen nennen, sondern es sei euch alles gemeinsam, und einem jeden soll durch die Hand des Priors, das heißt durch den Bruder, der von ihm mit diesem Dienst betraut ist, zugeteilt werden, was er braucht, unter Berücksichtigung des Alters und der notwendigen Bedürfnisse jedes einzelnen.
13. Wenn es nötig ist, dürft ihr Esel oder Maultiere halten, ebenso einen kleinen Bestand an Vieh oder Geflügel.
14. Ein Oratorium soll, sofern es leicht geschehen kann, inmitten der Zellen errichtet werden, in dem ihr Tag für Tag frühmorgens zusammenkommen sollt, um der Messe beizuwohnen, wo dies leicht geschehen kann.
15. Besprecht an den Sonntagen oder, falls notwendig, auch an anderen Tagen, die Beobachtung eures Ordenslebens und das geistliche Wohl; dabei sollen auch Übertreibungen und Fehler der Brüder, wenn solche bei jemandem wahrgenommen werden, in Liebe korrigiert werden.
16. Beobachtet das Fasten vom Fest Kreuzerhöhung bis zum Tag der Auferstehung des Herrn an jedem Tag, mit Ausnahme der Sonntage, es sei denn, dass Krankheit, körperliche Schwäche oder ein anderer berechtigter Grund dazu rät, das Fasten aufzuheben, denn Not kennt kein Gebot.
17. Enthaltet euch des Essens von Fleisch, außer es wird als Heilmittel bei Krankheit oder Schwäche gebraucht. Und weil ihr häufig betteln müsst, wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr, um den Gastgebern nicht zur Last zu fallen, außerhalb eurer Häuser gekochte Speisen mit Fleisch zu euch nehmen. Doch es ist auch erlaubt, auf See Fleisch zu essen.
18. Weil aber das Leben des Menschen auf Erden eine Prüfung ist und alle, die in Christus ein frommes Leben führen wollen, Verfolgung leiden, euer Widersacher, der Teufel, zudem wie ein reißender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, sollt ihr mit aller Sorgfalt eifrig bestrebt sein, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, damit ihr den Anschlägen des Feindes widerstehen könnt.
19. Zu gürten sind die Lenden mit dem Gürtel der Keuschheit; zu wappnen ist die Brust mit heiligen Gedanken, denn es steht geschrieben: Ein heiliger Gedanke wird dich behüten. Anzulegen ist der Panzer der Gerechtigkeit, so dass ihr den Herrn, euren Gott aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit allen Kräften lieben könnt und euren Nächsten wie euch selbst. Bei allem muss der Schild des Glaubens ergriffen werden, mit dem ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen könnt, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch der Helm des Heils ist aufzusetzen, damit ihr allein vom Heiland euer Heil erhofft, der sein Volk von seinen Sünden erlöst. Das Schwert des Geistes aber, das ist das Wort Gottes, wohne mit seinem ganzen Reichtum in eurem Mund und in eurem Herzen, und alles, was immer ihr zu tun habt, geschehe im Wort des Herrn.
20. Ihr sollt irgendeine Arbeit verrichten, so dass der Teufel euch immer beschäftigt findet und nicht wegen eurer Untätigkeit einen Zugang finden kann, um in eure Seele einzudringen. Hierzu habt ihr die Unterweisung und zugleich das Beispiel des heiligen Apostels Paulus, durch dessen Mund Christus gesprochen hat und der als Verkünder und Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit von Gott bestellt und uns gegeben ist. Wenn ihr ihm folgt, könnt ihr nicht irregehen. “Tag und Nacht haben wir gearbeitet”, sagt er, “um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt; wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi, des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen.” Dieser Weg ist heilig und gut, auf ihm müsst ihr gehen!
21. Der Apostel aber empfiehlt das Schweigen, wenn er vorschreibt, in Ruhe zu arbeiten, wie auch der Prophet bezeugt: “Die Übung der Gerechtigkeit ist das Schweigen.” Und ferner: “Im Schweigen und in der Hoffnung liegt eure Stärke.” Deshalb ordnen wir an, dass ihr nach dem Beten der Komplet das Schweigen halten sollt, bis die Prim des folgenden Tages gebetet ist. Wenn auch in der übrigen Zeit das Schweigen nicht so sehr gewahrt zu werden braucht, hüte man sich dennoch sorgfältig vor Geschwätzigkeit, denn wie geschrieben steht und nicht minder die Erfahrung lehrt: “Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus” und “Wer unbedachtsam im Reden ist, dem ergeht es übel.” Sodann: “Wer viele Worte macht, schadet seiner Seele.” Und der Herr selbst sagt im Evangelium: “Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen.” Daher wäge ein jeder seine Worte und zügle seine Zunge, damit er nicht strauchle und durch seine Rede zu Fall komme und sein Fall unheilbar zum Tod führe. Mit dem Propheten achte jeder auf seine Wege, damit er sich mit seiner Zunge nicht verfehle, und er mühe sich sorgfältig und gewissenhaft um das Schweigen, in dem die Übung der Gerechtigkeit besteht.
22. Du aber, Bruder B., und jeder, der nach dir als Prior eingesetzt wird, erwägt stets im Geist und befolgt in der Tat,was der Herr im Evangelium sagt: “Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein.”
23. Ihr übrigen Brüder aber, ehrt demütig euren Prior, indem ihr eher an Christus denkt, der ihn über euch gesetzt hat, als an ihn selbst, und der zu den Vorstehern der Kirche gesagt hat: “Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab”, damit ihr nicht wegen Verachtung gerichtet werdet, sondern durch Gehorsam den Lohn des ewigen Lebens verdient.
24. Dies haben wir euch in Kürze geschrieben, um euch eine Regel zu geben, nach der ihr leben sollt. Will aber einer noch mehr tun, dann wird es ihm der Herr selbst vergelten, wenn er wiederkommt. Er gebrauche jedoch die Gabe der Unterscheidung, die die Richtschnur der Tugend ist.
 |  |  |
|---|---|---|
 neues_tor_jerusalem_mrh_18608_550 |  zelt-neues-jerusalem-edicule-73336730 |  R - 2024-10-16T144329.101 |
 dd4uvl5-3b6ade56-9d20-49fc-81d9-64d5b120ed5e (1) |  OIP - 2024-10-16T144459.564 |  22912 |
 not-ready-ningxia-art-museum-cctn-design_7 |  c98e1d695fa2ca8a4929795f2a561d2e |  OIP - 2024-10-16T144145.594 |
 v2-c6673ae2dfe3ca2d31b4b0f6b6fdffeb_r |  21-DIVISION-OF-CANAAN |  germany-1489365_1280 |
Mein Gott ist Freude
Der Personenname אֲבִגַיִל avigajil, deutsch ‚Abigajil‘ (1 Sam 25,3 EU) ist aus zwei Elementen zusammengesetzt. Dabei ist der erste Teil vom hebräischen אֲבִי avi, deutsch ‚mein Vater‘ und der nachfolgende von dem Verb געל ga‘al, deutsch ‚freuen, jubeln‘ abgeleitet.
Übersetzt bedeutet der Name somit „Mein Vater ist Freude“.
Hierbei kann „Vater“ auch als Synonym für eine Gottheit aufgefasst werden, sodass „Mein Gott ist Freude“ eine weitere Übersetzungsmöglichkeit ist.











Griechische Göttin Athene
Athene (altgriechisch Ἀθήνη Athḗnē) oder Athena (Ἀθηνᾶ Athēná) ist eine Göttin der griechischen Mythologie. Sie ist die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes, der Künste, des Handwerks und der Handarbeit sowie Schutzgöttin und Namensgeberin der griechischen Stadt Athen. Sie gehört zu den zwölf olympischen Gottheiten. Ihr entspricht Minerva in der römischen Mythologie.
Der bedeutendste Tempel der Athene war – nach der Zerstörung ihres Tempels als Stadtgöttin durch die Perser im Jahr 480 v. Chr. – der ab 447 v. Chr. errichtete Parthenon auf der Athener Akropolis. Hier standen zudem mehrere bedeutende Athenastatuen des Bildhauers Phidias. Die größte und weithin sichtbare Statue stellte die Athena Promachos („in vorderster Reihe kämpfende Athene“) in voller Rüstung dar. Ebenso berühmt war die aus Gold und Elfenbein geschaffene Kolossalstatue der Athena Parthenos („Jungfrau Athene“) im Parthenon.
 |  |  |  |
|---|---|---|---|
 |  |  |  |
 |  |  |





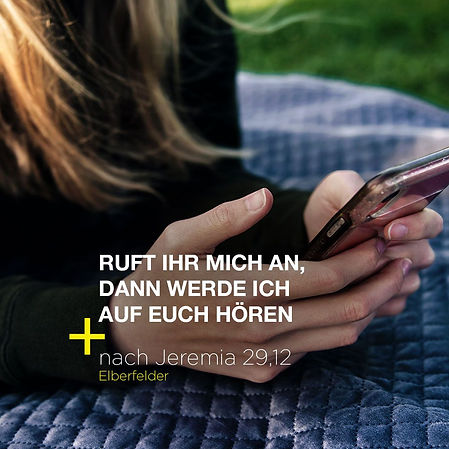


Psalm 10
Klage und Zuversicht beim Übermut der Frevler
1 HERR, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? 2 Weil der Frevler Übermut treibt, müssen die Elenden leiden; sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. 3 Denn der Frevler rühmt sich seines Mutwillens, und der Habgierige sagt dem HERRN ab und lästert ihn. 4 Der Frevler meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. »Es ist kein Gott«, sind alle seine Gedanken. 5 Er fährt fort in seinem Tun immerdar. / Deine Gerichte sind ferne von ihm, er handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. 6 Er spricht in seinem Herzen: »Ich werde nimmermehr wanken, es wird für und für keine Not haben.« 7 Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug; seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. 8 Er sitzt und lauert in den Höfen, / er mordet die Unschuldigen heimlich, seine Augen spähen nach den Armen. 9 Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht, / er lauert, dass er den Elenden fange; er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. 10 Er duckt sich, kauert nieder, und durch seine Gewalt fallen die Schwachen. 11 Er spricht in seinem Herzen: »Gott hat’s vergessen, er hat sein Antlitz verborgen, er wird’s nimmermehr sehen.« 12 Steh auf, HERR! Gott, erhebe deine Hand! Vergiss die Elenden nicht! 13 Warum lästert der Frevler und spricht in seinem Herzen: »Du fragst doch nicht danach«? 14 Du siehst es ja, / denn du schaust das Elend und den Jammer; es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir; du bist der Waisen Helfer. 15 Zerbrich den Arm des Frevlers und Bösen / und suche seinen Frevel heim, dass man nichts mehr davon finde. 16 Der HERR ist König immer und ewiglich; die Heiden sind verschwunden aus seinem Lande. 17 Das Verlangen der Elenden hörst du, HERR; du machst ihr Herz gewiss, dein Ohr merkt darauf, 18 dass du Recht schaffest den Waisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden.


10 - DIE WIEDERGEBURT CHRISTSEIN & JUDENTUM Das neue Apokryphe Evangelien 2025 - 2033 Der Lohn des Wartens Reich der Göttinnen: DEMETER - Athene - Selene - Aurora - Ceres - DIKE - Eirene Im Christentum wird sie oft als ein Teilaspekt der Erneuerung des Menschen durch Gott verstanden Eine Neue Heilige Schrift DIGITAL Powered by VoIP - EASYBELL - 1&1 - GALILEO SYSTEMS - Babelsberg Film Studios - Copyright © 2025